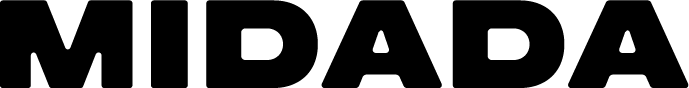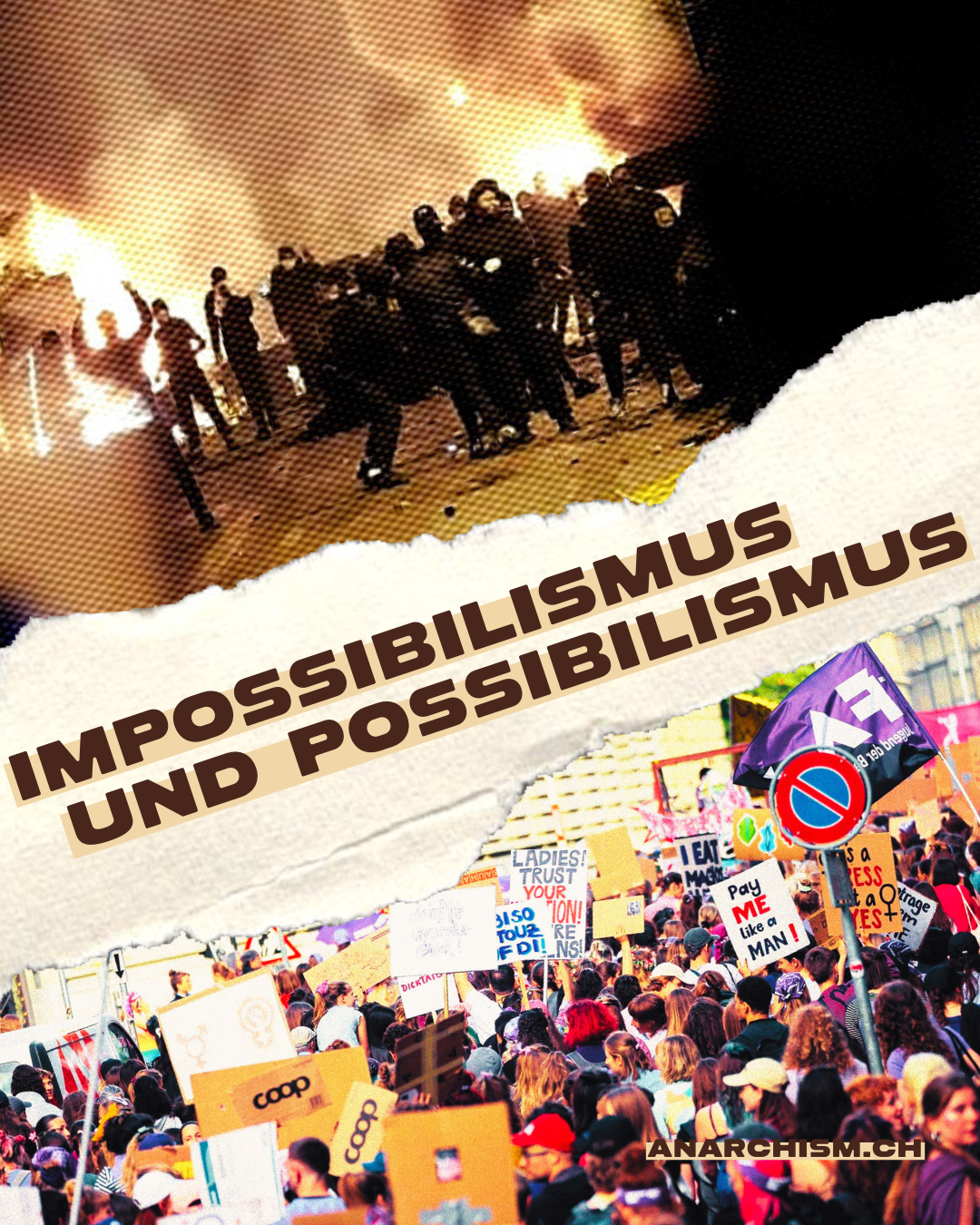In den fast 160 Jahren seit der Entstehung des Anarchismus als eigenständiger Zweig der sozialistischen Bewegung gab es erbitterte Debatten darüber, welcher Weg am direktesten und wirksamsten zur sozialen Befreiung führen sollte. Obwohl diese Diskussion viele Dimensionen hat, bleibt die strategische Ausrichtung zentral. Die Frage der Strategie taucht immer wieder in der Geschichte des Anarchismus auf, in nahezu jedem Land und Kontext, in dem die Bewegung Fuss gefasst hat. Eine klare Trennlinie zwischen den verschiedenen Ideenströmungen lässt sich ziehen, indem man die gegensätzlichen Lager unter den Oberbegriffen Impossibilismus und Possibilismus zusammenfasst.
Impossibilismus
Der Impossibilismus zeichnet sich durch die Überzeugung aus, dass kurzfristige oder unmittelbare Erfolge bzw. Reformen keinen Beitrag zum Weg in Richtung sozialer Revolution leisten. Viele Impossibilist*innen vertreten die Ansicht, dass jegliche Erfolge, die unterhalb einer vollständigen Revolution liegen, vielmehr dazu beitragen, die unterdrückten Klassen „ruhigzustellen“ und ihren Unmut daran hindern, in offene Rebellion umzuschlagen. Weitere Impossibilist*innen kommen zu dem Schluss, dass Reformen, selbst wenn sie durchgesetzt werden, langfristig von der herrschenden Klasse wieder rückgängig gemacht werden, die bestrebt ist, ihre Verluste zurückzugewinnen. So wird der Kampf um kurzfristige Erfolge zu einem sprichwörtlichen „Karotte am Ende des Stocks“-Szenario, bei dem die unterdrückten Klassen ständig auf etwas hinarbeiten, das letztlich nicht erreichbar ist.
Possibilismus
Der Possibilismus hingegen vertritt die differenzierte Ansicht, dass kurzfristige Erfolge wirksam in Richtung eines revolutionären Ziels genutzt werden können. Possibilist*innen betonen, dass solche kurzfristigen Erfolge oder Reformen, um wirklich nützlich zu sein, von unten durch massenbasierte direkte Aktionen erkämpft werden müssen. Sie sollen nicht von oben durch die vermeintliche Grosszügigkeit von Politiker*innen oder Kapitalist*innen gewährt werden. Ein weiterer zentraler Aspekt der possibilistischen Position ist die Überzeugung, dass jegliche den Herrschenden abgerungenen Zugeständnisse das Selbstvertrauen, die Kampfbereitschaft und die Fähigkeiten der Unterdrückten stärken. Dieser Prozess, wenn er von unten geführt und langfristig aufrechterhalten wird, soll die unterdrückten Klassen auf eine revolutionäre Auseinandersetzung mit Staat und Kapital vorbereiten.
In der Praxis
Nun, da wir die Begriffe definiert haben, wollen wir betrachten, wie diese Positionen in die politische Praxis umgesetzt wurden. Impossibilist*innen, die sich wenig für unmittelbare soziale Verbesserungen interessieren oder sie sogar grundsätzlich ablehnen, haben sich grösstenteils von sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und anderen Formen massenbasierten Engagements ferngehalten, weil sie sie als reformistisch und letztlich aussichtslos betrachten. Stattdessen neigen Impossibilist*innen dazu, ihre Ideen durch individuelle oder kleinerer Aktionen von eingeweihten Gruppen zu verwirklichen. Dies schliesst die berüchtigte Strategie der „Propaganda der Tat“ ein. Also Attentate, Bombenanschläge und andere Formen des Terrors, von denen Impossibilist*innen glauben, dass sie die herrschenden Klassen schwächen. Ebenfalls sollen diese Aktionen andere Leute zu ähnlichen Taten inspirieren.
In der Praxis II
Impossibilist*innen fanden ein natürliches Zuhause im aufständischen Anarchismus (Insurrektionalismus) gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Gefördert durch Figuren wie Luigi Galleani und Johann Most und dann weiter verstärkt durch prominente Stimmen wie Kropotkin, Goldman und Malatesta, erreichten diese Ideen ihren Höhepunkt mit einer Welle hochkarätiger Attentate, darunter das auf König Umberto I. von Italien im Jahr 1900 und auf den US-Präsidenten William McKinley im Jahr 1901. Bis Mitte der 1910er-Jahre führte die harte staatliche Repression gegen solche Aktionen dazu, dass die anarchistische Bewegung in den USA und Europa erheblich geschwächt wurde. Besonders in den USA isolierte die Aufstandsstrategie anarchistische Ideen von den unterdrückten Klassen. Anstatt Massenaktionen zu inspirieren, wurden Anarchist*innen zunehmend als selbsternannte Eliten wahrgenommen, die keinen Bezug zu den alltäglichen Kämpfen der einfachen Menschen hatten. Letztendlich distanzierten sich Kropotkin, Goldman, Most und Malatesta von reinem Insurrektionismus und Impossibilismus.
In der Praxis III
Die possiblistische Position ist dem Anarchismus vermutlich seit der Spaltung der Ersten Internationale eigen. Bakunin selbst setzte sich dafür ein, anarchistische Ideen und Taktiken in soziale Bewegungen zu integrieren mit dem Ziel, sie kämpferischer und fähiger zu machen, Erfolge zu erzielen und schliesslich eine soziale Revolution zu tragen. Syndikalist*innen waren ebenfalls entschiedene Vertreter des Possibilismus. Sie vertraten die Ansicht, dass es notwendig sei, in grossen Gewerkschaften mitzuarbeiten und sie zu radikalisieren oder freiheitliche Gewerkschaften aufzubauen, um so deren Fähigkeit zu stärken, Kapitalismus und Staat letztlich zu stürzen. Jedoch hat der Possbilismus die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes nie abgelehnt. In vielen Fällen wurden geheime bewaffnete Sektionen innerhalb von Gewerkschaften und Organisationen geschaffen, wie beispielsweise die Verteidigungskomitees der spanischen CNT. Der Unterschied zum Impossibilismus bestand in ihrer Betonung auf strategisches Timing und kollektive direkte Aktionen.
Heute
In den letzten 30 Jahren hat der aufständische Impossibilismus eine Wiederbelebung erfahren. Seine Befürworter*innen sind jedoch auf dieselben Probleme gestossen wie der historische Impossibilismus: Der begrenzte spektakuläre Aktionismus führte zur Isolation von der breiten Öffentlichkeit. Einige Vertreter*innen dieser Position haben das Ziel einer sozialen Revolution vollständig aufgegeben und lassen sich stattdessen von einem ziellosen Nihilismus treiben. Verschiedene Formen des revolutionären Possibilismus haben in den letzten Jahrzehnten ebenfalls an Bedeutung gewonnen. Syndikalistische Gewerkschaften und ihre Föderationen bestehen weiterhin (IWA-AIT-IAA, ICL-CIT-IKA). Darüber hinaus fallen zahlreiche teils neu gegründete spezifisch anarchistische Organisationen in die possibilistische Kategorie (wie Die Plattform, Union Communiste Libertaire, Embat, Black Rose/Rosa Negra).