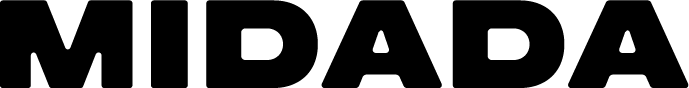Grundsatzpapier
1. Das Bestehende verstehen
Soziale Situation
Die Schweiz ist eines der reichsten Länder weltweit. Innerhalb der Schweiz sind die Einkommen und Vermögen aber stark ungleich verteilt. Doch weil die Schweiz insgesamt wohlhabend ist, entsteht die gängige Haltung, dass niemand unter Armut leiden müsse. Armut ist relativ und kann nur in Bezug auf die regionalen Umstände und Lebenskosten betrachtet werden. Die prekären Lebenslagen sind vielfältig. Über 300‘000 Menschen in der Schweiz beziehen Sozialhilfe. Eine grosse Zahl von Menschen können sich zwar eine Art von Dach über dem Kopf und eine Form von Nahrung leisten, können aber, weil sie zu wenig Geld haben, nicht am gesellschaftlichen Leben (etwa Konzerte, Restaurants, Theater, Ausgang) teilnehmen. Genau weiss aber niemand, wie viele Menschen in der Schweiz von Armut betroffen sind oder an der Armutsgrenze stehen, weil Zahlen zu unterschiedlichen prekären Lebenslagen fehlen. Die Caritas spricht jedoch von 1,3 Millionen Menschen, die im Jahr 2024 armutsbedroht sind.
Wir stellen fest, dass die unterschiedlichen Menschen, welche in prekären Verhältnissen leben, in verschiedene, spezifische Kategorien eingeteilt und oftmals gegeneinander ausgespielt werden. Verschlechterungen können bei einzelnen Gruppen einfach eingeführt werden – und nach einer Testphase auf andere Bereiche ausgeweitet werden. So wurden beispielsweise die Leistungen in der Nothilfe für Asylsuchende gekürzt. Später wurde diese Praxis den Grundbedarf der Sozialhilfe für unter 25-jährigen und auf weitere unterstützte Personengruppen ausgeweitet.
Bis in die 1960/70er Jahre wuchsen die sozialstaatlichen Sicherungssysteme in der Schweiz und deckten Notlagen in vielen Lebensbereichen zu einem gewissen Mass ab. Ein System von Sozialhilfe, Nothilfe, Invalidenversicherung, Ergänzungsleistungen, Altersvorsorge (AHV, BVG, Pensionskasse), Arbeitslosenversicherung, Krankenkassen, und anderen sollten eigentlich die soziale Sicherheit und den Anspruch des Staates seinen Bürger*innen ein «menschenwürdiges Dasein», wie es die Bundesverfassung in Artikel 12 verspricht, garantieren. Seitdem erleben wir den fortschreitenden Abbau dieser Sicherungssysteme. Gründe hierfür sind unter anderem der Einfluss der neoliberalen Politik sowie einer zugespitzten globalen Konkurrenz und eines gesteigerten Klassenkampfs von oben (→ Klassen). Die Interessen grosser Firmen und der besitzenden Klasse werden höher gewertet und auf parlamentarisch politischer Ebene rücksichtslos durchgesetzt (→ Staat). Dies sehen wir beispielsweise an den unterschiedlichen Versuchen, die Unternehmenssteuern in der Schweiz zu senken. Wenn dann diese Steuergelder von Unternehmen wegfallen, argumentieren bürgerliche Politiker*innen, dass die Gelder für sozialstaatliche Sicherungssysteme fehlen. Diese werden in dieser Logik laufend gekürzt und drängen einen Teil der Lohnabhängigen in noch prekärere Situationen (→Parlamentarismus).
Teile dieser Entwicklung sind die Vermarktlichung und Privatisierungen von Leistungen des Sozialstaates, die Kürzung sozialstaatlicher Leistungen, die Koppelung von Sozialleistungen an die Erfüllung strenger Anforderungen und damit eine schleichende Aushebelung des Absicherungsgedanken der staatlichen Sozialversicherungssysteme. In der Schweiz ist zudem der Grundgedanke vorherrschend, dass Menschen für ihre Verhältnisse selbst verantwortlich sind. Somit löst der zunehmende Neid die gewünschte Solidarität ab, weil die «fleissigen Arbeiter*innen» nicht für die «Sozialschmarotzer*innen» bezahlen wollen. Diese Haltung verunmöglicht einen solidarischen, entstigmatisierten Umgang mit den Themen Armut, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter, Beeinträchtigung und Sucht.
Die Angriffe auf die sozialen Sicherungssysteme sorgen für materielle Not, soziale Ausgrenzung und massive gesundheitliche Probleme von immer mehr Menschen unserer Klassen. Gleichzeitig verbreiten sich Abstiegsängste und Anpassungsdruck. Die zugespitzte globale Konkurrenz hat trotz deutlicher Produktivitätssteigerungen eine Erhöhung der tatsächlichen Lohnarbeitszeit und der Anforderungen am Arbeitsplatz zur Folge. Es findet eine Prekarisierung der Arbeitswelt statt. Kurze Anstellungsverhältnisse (sowie Nullstundenverträge/Arbeit auf Abruf) und eine verstärkte Austauschbarkeit setzen Lohnabhängige unter Druck und verkleinern deren Handlungsmöglichkeiten.
Vor allem migrantische Lohnabhängige arbeiten in prekären Arbeitsbereichen. Sie sind aufgrund Herkunft, Sprachkenntnissen, eingeschränkter Vernetzung und der fehlenden Anerkennung von bisheriger schulischer und beruflicher Erfahrung benachteiligt und erpressbar. Chef*innen stellen migrantische Lohnarbeiter*innen zu geringeren Löhnen an, halten sich nicht an das Arbeitsrecht und drohen bei Widerstand mit Entlassungen. Auch bei den Ansprüchen von Leistungen der Sozialversicherungen sind migrantische Menschen diskriminiert, da diese oft von Einzahlungsjahren und Höhe der Einzahlungsbeträgen abhängig sind. Zudem kann der Bezug von Sozialhilfe ohne Schweizerpass zu einer Rückstufung resp. zum Verlust der Aufenthaltsbewilligung führen. Geflüchtete Menschen, (abgewiesene) Asylsuchende und Sans Papiers leiden einerseits unter starker Repression, die mit strukturellem Rassismus zusammenhängt, andererseits werden sie durch das Asylsystem systematisch vom Rest der Gesellschaft isoliert. Dies zeigt sich beispielsweise an den abgelegenen Standorten der Lager und an dem Zwang, dass die Menschen immer in den ihnen zugewiesenen Lagern übernachten müssen (→ Rassismus).
Durch Vereinzelung und Auslagerung werden die gemeinsamen Interessen der Arbeiter*innen verschleiert, was einen gemeinsamen Widerstand erschwert. Die in der Logik des sozialen Friedens gefangenen Zentralgewerkschaften haben auch keine Antwort auf diese Entwicklungen – Arbeitskämpfe oder grössere Streiks sind deswegen eine Seltenheit. Nachhaltig wirkende Protest- und Widerstandsformen für soziale Themen jeglicher Art sind kaum verbreitet und wo diese existieren, beschränken sie sich zum Grossteil auf individuell handelnden Einzelpersonen. Diese Handlungen bleiben damit für Aussenstehende unsichtbar und in ihrer Wirkung wenig erfolgreich. Aber sie können anschlussfähig für kollektiv geführte Kämpfe werden (→ Arbeiter*innenbewegung und Gewerkschaften). Zudem stellen wir fest, dass einzelne Proteste unter Ausschluss der Betroffenen oder mangelnder Zugänglichkeit für diese stattfanden. Der Widerstand und die Unterstützung im Einzelfall sind ebenfalls schwierig, da die unterschiedlichen sozialstaatlichen Akteur*innen intransparent handeln und Entscheidungen willkürlich fällen. Die schwammigen gesetzlichen Grundlagen und wenigen Präzedenzfälle machen es ebenfalls schwieriger, sich auf juristischer Ebene gegen Entscheide zu wehren. Es fehlen unabhängige, kostenlose Rechtsberatungs- und transparente Ombudsstellen.
Die Lebenskosten in der Schweiz sind im weltweiten Vergleich sehr hoch. Ein grosser Teil der Lohnabhängigen kann diese nicht oder kaum bewältigen. Der (soziale) Wert, «einer Arbeit nachzugehen» und den Lebensunterhalt finanziell selbstständig zu bewältigen, ist enorm hoch. Sozialstaatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen, wird verpönt und zeugt von selbstverschuldeter Niederlage. Arbeitslosengelder sind an die Auflage gekoppelt, alles zu unternehmen, um baldmöglichst wieder in den Arbeitsmarkt reintegriert zu sein. So müssen sich Arbeitslose und Menschen mit Behinderung im zweiten und dritten Arbeitsmarkt – in Arbeitsintegrationsprogrammen – beschäftigen. Dies ist ein Ausdruck der weit verbreiteten, bürgerlichen Ansicht, dass Leistungen immer mit Gegenleistungen verbunden sein müssen. Solche Arbeitsintegrationsorte bieten Dienstleistungen und Produkte, welche zu Billiglöhnen produziert und angeboten werden können. Diese stellen eine absurde Konkurrenz für Lohnabhängige im ersten Arbeitsmarkt dar. Das Konzept der zweiten und dritten Arbeitsmöglichkeiten zwingt Menschen in erniedrigende Verhältnisse. Es ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen, dass das Ziel der «Reintegration» erreicht wird.
Ein weiterer Faktor des wachsenden sozialen und ökonomischen Drucks auf die Klasse der Lohnabhängigen sind steigende Mieten. Dies zeigt sich noch stärker in den Städten, in denen ganze Viertel durch Gentrifizierungsprozesse «aufgewertet» und die bestehende Wohnbevölkerung durch die erhöhten Mieten verdrängt werden. Das führt zusätzlich zum Verlust oder der Beschädigung von sozialen Beziehungen, die mit dem Wohnumfeld zusammenhängen.
Zahlen zu Obdachlosigkeit können in der Schweiz nur teilweise erfasst werden. Trotzdem konnte die erste Studie feststellen, dass zum Zeitpunkt der Messung mindestens 2200 Menschen in der Schweiz wohnungslos und 8000 Menschen von bevorstehendem Wohnungsverlust bedroht waren. Wohnungslose Menschen übernachten in den wenigen Plätzen in Notunterkünften, bei Bekannten oder im öffentlichen Raum (rough sleepers). In der Obdachlosenhilfe besteht die Vorstellung eines Stufenkonzepts, welches die Menschen aus der Obdachlosigkeit «befreit», über ein betreutes Wohnen, zum begleiteten Wohnen bis zum autonomen Wohnen wieder integrieren und Wohnkompetenz vermitteln soll, während das eigentliche Bedürfnis von wohnungslosen Menschen nicht berücksichtigt wird: Sie wollen (sicher) wohnen.
Klassen
Der Kapitalismus ist das aktuelle Wirtschaftssystem. Er umfasst alle Gesellschaftsbereiche und wir leben alle darin, ganz egal, wo wir wohnen (→ Kapitalismus). Dieses System funktioniert nur über die Unterdrückung und Ausbeutung fast aller Menschen durch ein paar wenige. Diese ganz vielen sind wir, die lohnabhängigen Klassen: Die Angehörigen dieser Klassen sind darauf angewiesen, ihre Arbeitskraft für Lohn zu verkaufen, um überleben zu können. Sie werden durch die Klassen der Kapitalist*innen unterdrückt, welche die Produktionsmittel, also Unternehmen, Fabriken, Häuser sowie Grossgrundstücke und/oder Ressourcen besitzen und kontrollieren. Die Klassen haben entgegengesetzte Interessen, die sich nicht vereinen lassen: Chef*innen wollen dir einen möglichst geringen Lohn bezahlen. Dies nicht unbedingt, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil etwa das Überleben der Firma auf dem Spiel steht. Du hingegen willst einen möglichst hohen Lohn, damit du auch mal die Füsse hochlagern kannst. Wir sind eine Organisation, die für die Interessen der unterdrückten Klassen kämpft.
Grundlage der Ausbeutung und Unterdrückung der lohnabhängigen Klassen ist das Privateigentum an Produktionsmitteln, Ressourcen und lebenswichtigen Gütern. Die Hauptaufgabe des Staates ist der Schutz des Privateigentums, wofür er sein durch Gesetze garantiertes Gewaltmonopol einsetzt. Das heisst nicht nur, dass du mit körperlicher Gewalt daran gehindert wirst, etwas zu klauen. Schon das Wissen, dass du bestraft werden kannst, wenn du erwischt wirst, reicht meistens aus. Zu dieser direkten und indirekten Gewalt kommen noch Gesetze. Dank den Gesetzen ist es einfach, reich zu bleiben und schwierig reich zu werden. Dies ist die institutionelle Gewalt. Weil die lohnabhängigen Klassen dies mittlerweile so fest verinnerlicht haben, ist ein sozialer Frieden möglich, auch wenn die Gegensätze zwischen den Klassen nicht verschwunden sind. Die besitzenden und die lohnabhängigen Klassen können durch zwei Steinböcke dargestellt werden, die kurz davor sind, die Köpfe aneinander zu schlagen. Falls sie das tun, ist das ein offener Klassenkampf oder Klassenkonflikt. Nur weil die Steinböcke in einem Moment gerade nicht aufeinander losgehen, ist der Konflikt aber nicht gelöst: Auch wenn ein scheinbarer sozialer Frieden herrscht, bestehen die entgegengesetzten Interessen der Klassen weiter.
Der soziale Frieden wird nicht nur über diese Gewaltverhältnisse gewahrt, sondern auch mit anderen Mitteln. Etwa durch die in den Gesetzen und den Köpfen verankerte Form der Gewerkschaftsarbeit. Funktionär*innen und Bosse sitzen gemütlich in einer Runde und handeln Verträge aus (Sozialpartnerschaft). In den meisten von diesen Verträgen, den Gesamtarbeitsverträgen, werden dann Kampfmassnahmen verboten (Friedenspflicht) oder durch die glänzende Konsumwelt, die dazu verlockt, reale gesellschaftliche Probleme zu vergessen. Ein anderes Mittel ist die Zerstörung von sozialen Beziehungen. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Gentrifizierung, also dass lebendige Nachbarschaftsstrukturen in Arbeiter*innenvierteln durch Aufwertungen und Mietpreiserhöhungen und daraus folgender Verdrängung zerstört werden. Durch die daraus folgende Vereinzelung werden Gemeinsamkeiten verschleiert und Organisierungen erschwert. Entscheidungsträger*innen wollen uns glauben lassen, dass es zu Kapitalismus und Herrschaft keine Alternative gibt – und sichern und rechtfertigen ihre Herrschaft durch scheinbare oder kaum bezahlbare Mitbestimmung.
Die Klassen kennen keine regionalen oder staatlichen Grenzen – die Situation etwa von Velokurier*innen in Bern und in Yokohama ähneln sich. Klar gibt es Unterschiede zwischen den Regionen und den jeweiligen Lebensverhältnissen, aber die Gemeinsamkeiten zwischen den Kurier*innen sind grösser als die zwischen ihnen und reichen Grossunternehmer*innen am selben Ort. Im Gegensatz etwa zu der klassischen marxistischen Lehre gibt es aber nicht einfach nur zwei klar definierte Klassen, die einander unversöhnlich gegenüberstehen. Die Realität ist komplizierter: Topmanager*innen besitzen eigentlich keine Produktionsmittel und beziehen auch Lohn. Sie zu den lohnabhängigen Klassen zu zählen, wäre aber gewagt, wenn wir auf ihre Millionengehälter schauen. Selbständige Handwerker*innen auf der anderen Seite besitzen Werkzeuge und Maschinen und Lieferwagen, also Produktionsmittel. Sie können aber trotzdem kaum zu den besitzenden Klassen gezählt werden, da sie auf ihre eigene Arbeit angewiesen sind, um zu überleben. Auch durch Systeme mit mehreren Subunternehmen gibt es neue Arten von Chef*innen. Gleichzeitig sind sie aber auch selbst jederzeit ersetzbar und ebenso lohnabhängig, nur bekommen sie ein etwas grösseres Stück vom Kuchen.
Andererseits gehören auch Menschen zu den lohnabhängigen Klassen, die keinen Lohn erhalten. Dazu gehören beispielsweise Eltern, die für ihre Sorge- und Hausarbeit keinen Lohn erhalten, Arbeitslose oder IV-Bezüger*innen. Hinzu kommen andere Lebensrealitäten, die in unserer Region selten vorkommen, aber ebenfalls darunterfallen: Unter anderem diejenigen, die keine reguläre, legale Arbeit haben (informelle Arbeit) oder von selbst gesammelten, gejagten und selbst angebauten Lebensmitteln und Gütern, also von Subsistenzwirtschaft, leben.
Damit das kapitalistische System Erfolg haben kann, muss die Mehrheit der Menschen der Überzeugung sein, dass sie nichts ändern können – was auch stimmt, wenn es nur Einzelne versuchen. Die Macht der Lohnabhängigen ist aber unermesslich, wenn sie zusammen handeln. Das Bewusstsein zu diesen Klassen und das Verständnis, zu welcher Klasse wir gehören, ist Voraussetzung, damit wir handlungsfähig sein können. Deswegen lehnen wir das Konzept Mittelschicht ab, auch wenn wir von mehr als zwei Klassen sprechen. Mittelschicht ist ein schwammiger Begriff, der fast alle einschliesst und darum die Gegensätze zwischen den Klassen verwischt – es gibt für fast alle Menschen Gruppen, die unter und über ihnen stehen.
Eine Klasse ist keine unteilbare Einheit. Andere Macht- und Unterdrückungsformen spielen ebenso eine Rolle: Zum Beispiel können Klassen entlang von Geschlecht, Hautfarbe und Sprache gespalten werden. Dies benützen die besitzenden Klassen gerne, um die Kosten tief zu halten: FINTA und Ausländer*innen erhalten zum Beispiel oft weniger Lohn (→ Patriarchat, → Rassismus). Dies ist natürlich nicht der Fehler dieser Menschen, sondern die besitzenden Klassen nutzen die fehlende Einheit der lohnabhängigen Klassen aus.
Ein Staat kann die wirtschaftliche Stellung einer Person fördern oder einschränken. Deswegen können wir nicht über Klassen sprechen, ohne die Machtverhältnisse zu betrachten. Deine Hautfarbe, deine politische Haltung, dein Geschlecht oder dein Glaube können deine Kassenzugehörigkeit unabhängig von der wirtschaftlichen Stärke von dir oder deinen Eltern bestimmen. Ebenfalls kann eine Person die Klassenzugehörigkeit wechseln, aufgrund ihrer Stellung innerhalb des politischen Systems (→ Staat). So sind ranghohe Militärs oder Politiker*innen ebenfalls Teil der herrschenden Klasse und nicht Teil der unterdrückten Klassen, auch wenn sie keine Produktionsmittel besitzen. Jedoch haben sie durch ihre Position innerhalb des Staates oder einer mächtigen (staatsnahen) Organisation (→Arbeiter*innenbewegung und Gewerkschaften) grossen gesellschaftlichen Einfluss und sind in der Lage, die unterdrückten Klassen zu bevormunden.
Patriarchat
Das Patriarchat ist ein System, das soziale Beziehungen und Geschlechterverhältnisse in eine hierarchische Beziehung setzt, die in der Gesellschaft wirken. Es ordnet Geschlechterkategorien in unten und oben und beschreibt die Vorherrschaft des männlichen Geschlechts. Dies, in einer binären Geschlechterordnung, welche davon ausgeht, dass es ausschliesslich Männer und Frauen gibt.
Das Patriarchat existiert nicht seit jeher. Zahlreiche historische und archäologische Forschungen belegen dies. Auch heute noch gibt es Kulturen, die anders organisiert sind. Bei den Mosuo (Volksgruppe im Südwesten Chinas) etwa besitzen die Frauen Häuser, Höfe und Geschäfte und vererben sie an ihre Töchter weiter. Und die Männer kümmern sich um die Erziehung der Kinder ihrer weiblichen Verwandten. Bis heute wird darüber diskutiert, wann genau das Patriarchat entstanden ist und welche Faktoren seine Entwicklung ermöglicht haben. Es kann festgehalten werden, dass das Patriarchat vom Kapitalismus geprägt und dieses durch den Kapitalismus umgestaltet wurde. Gleichzeitig wurde der Kapitalismus auch durch das Patriarchat beeinflusst. So sind die Spaltung und das gegenseitige Ausspielen der Ausgebeuteten, z. B. entlang der Kategorie Geschlecht, wichtige Mechanismen der herrschenden Klassen bei der Aufrechterhaltung des Kapitalismus. Wir müssen also Patriarchat und Kapitalismus als voneinander abhängig verstehen.
Die sexistische Unterdrückung, der Rassismus (→ Rassismus) und die Klasse sind die drei sozialen Beziehungen, die wir in der Gesellschaft vorfinden, die alle auf einmal den Effekt haben, zu beherrschen, zu unterdrücken und auszubeuten. Diese sozialen Beziehungen gehen ineinander auf, verändern die Wirkung anderer Unterdrückung und haben somit eine Wechselwirkung untereinander. Deshalb sprechen wir von Intersektionalität. Unterdrückung und Ausbeutung sind jedoch nicht kumulativ, sondern qualitativ. Eine unterdrückte Person oder eine beherrschte Gruppe ist nicht unterdrückter als eine andere unterdrückte Person. Andererseits kann man auch nicht sagen, dass, da die Unterdrückungen nicht kumulativ sind, also alle gleich unterdrückt sind. Die Rolle, wie die eine oder andere Unterdrückungsform (Rassismus, Klasse und Patriarchat) in der Herrschaftsgesellschaft ausgeprägt ist, hängt auch von den Verhältnissen, die an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit gegeben sind, ab.
Das Patriarchat verstehen wir als die Gesamtheit aller Unterdrückungsmechanismen, die sich gegen Menschen richten, die keine cis Männer sind (cis bedeutet, dass sich die Person mit dem Geschlecht, welches ihr bei der Geburt zugeteilt wurde, identifiziert). Es durchdringt und wirkt in alle Lebensbereiche: Im ganz klassischen Sinne von der Stellung von Frauen in der Gesellschaft, über verschiedene Formen der Ausbeutung bis hin zu unseren alltäglichen Beziehungen. Weiter verunmöglicht es Geschlechteridentitäten jenseits des binären Geschlechterverhältnis, wie trans, inter und nicht-binäre Menschen.
Spätestens bei der Geburt wird jedem Menschen ein Geschlecht zugewiesen und dieses wird auch gewaltsam durchgesetzt, z.B. mit Operationen an den Geschlechtsteilen von inter Kindern, wenn die körperlichen Merkmale nicht eindeutig sind. Diese Zweiteilung der Geschlechter ist nebst der Vorrangstellung des Mannes die Grundlage des Patriarchats. Aber auch diese sogenannt natürliche Geschlechtertrennung ist eine soziale Konstruktion. Geschlecht kann keine natürliche Kategorie sein, denn eine Kategorie ist ein Gedankenkonstrukt.
Das Patriarchat liefert die Grundlage für Rollen- und Aufgabenteilungen und Verhaltensweisen, die den binären Geschlechtern zugeschrieben werden. Es entstanden Frauenberufe, die weiblich zugeordnete Charaktereigenschaften voraussetzen und als Gegenstück Männerberufe, die dem männlichen Geschlecht zugeschriebene Eigenschaften, wie Geschick, Logik, Intelligenz und physische Stärke, voraussetzen. Die ungleiche Entlöhnung bei gleicher Arbeit (Gender Pay Gap) ist ein offensichtlicher Ausdruck der (unter)ordnenden Wirkung des Patriarchats innerhalb der lohnabhängigen Klassen. Auch Verhaltensweisen werden nach wie vor entsprechend dem bei der Geburt zugeteilten Geschlecht zugeordnet. Verhalten sich Menschen nicht konform, als plakatives Beispiel würden Männer emotional mit Tränen auf Erlebnisse reagieren oder Frauen aggressiv und laut für ihre Rechte einstehen, löst dies negative Reaktionen aus. Dies zeigt auf, dass auch cis Männer trotz ihrer Privilegien, die durch ihr Geschlecht bestehen, die negativen Folgen des Patriarchats erleben und ihre Leben nicht so gestalten können, wie sie die eigentlich gerne würden, wenn sie nicht dem patriarchal definierten Bild des Mannes entsprechen.
Auf ökonomischer Ebene bedingt der Kapitalismus marginalisierte Gruppen. So brauchen die Kapitalist*innen für einen möglichst grossen Profit Menschen, die im Hintergrund all jene Arbeiten erledigen, welche dafür sorgen, dass die Arbeiter*innen jeden Morgen pünktlich zur Arbeit erscheinen können und wieder leistungsfähig sind. Diese Reproduktions- oder Care-Arbeiten werden in unserer Gesellschaft zu grössten Teilen von Frauen übernommen. Mütter, Putzfrauen, Erzieherinnen und Grossmütter sorgen so beispielsweise dafür, dass der Haushalt gemacht ist, Kinder zu wohlerzogenen, braven Arbeiter*innen erzogen und kranke Familienangehörige gepflegt werden. Wir teilen die These, dass die Rechnung im Kapitalismus nicht aufgehen würde, müssten Firmen und Staaten für all jene bis heute unbezahlte Arbeit entlöhnen. So haben Kapitalist*innen ein Interesse daran, dass diese Arbeiten weiterhin unbezahlt bleiben. Zudem hat die jahrelange unbezahlte Sorgearbeit weitere Konsequenzen. Durch nicht einbezahlte Beiträge in die zweite Säule, der beruflichen Vorsorge, tragen Frauen ein erheblich grösseres Risiko im Alter von Armut betroffen zu sein.
Wenn die Arbeiten nicht familienintern übernommen werden, können sich gutsituierte Menschen Reproduktionsarbeiten einkaufen. So übernehmen andere Menschen zu möglichst günstigen Konditionen jene Arbeiten. Diese Arbeiten werden von Kindertagesstätten, Putzdiensten oder privaten Haushalts- und Kinderbetreuungsdiensten übernommen. Oft werden diese Arbeiten an migrantische Frauen und women of colour weitergegeben, welche diese Aufgaben aus finanzieller Not annehmen und so einer Doppelbelastung von prekärer ökonomischer Situation durch schlecht bezahlte Care-Arbeit und der Care-Arbeit in der eigenen Familie ausgesetzt sind.
Weiter besteht auf dem Arbeitsmarkt eine offensichtliche Lohnungleichheit. Frauen verdienen nach wie vor weniger als Männer, haben höhere Abgaben bei den Gesundheitsversicherungen und erleben ungerechte Behandlung im Arbeitsrecht, wie zum Beispiel die Kündigung wegen oder während einer Schwangerschaft.
Viele FINTA sind von Gewalt aufgrund ihres Geschlechts betroffen. Diese äussert sich oft, wenn auch nicht ausschliesslich, in häuslicher Gewalt und Morden aus sexistischen Beweggründen (=Feminizid). Der grösste Teil aller FINTA erlebt in ihrem Leben sexualisierte Gewalt. Auf staatlicher Ebene bestehen Gesetzesartikel gegen sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt und für die materielle und immaterielle Hilfe von Betroffenen in Form von Opferhilfegesetzen. Diese Gesetze sind das Ergebnis von Kämpfen. Denn der Staat kümmert sich nicht aus eigenem Antrieb um die betroffenen Personen. Er stellt diese spärlichen Mittel unter sozialem Zwang zur Verfügung. Deswegen ist es notwendig, sich dauernd für den Erhalt dieser Mittel einzusetzen.
Die (para-)staatlichen Angebote bieten Betroffenen leider oft die einzige Möglichkeit, sich zu schützen, zu wehren oder mit dem Erlebten zurecht zu kommen. Es ist aber paradox, dass diese Gesetze in einem Staat bestehen, der Sexismus gleichzeitig reproduziert: Werden staatliche Repressionsorgane wie die Polizei aufgrund eines z.B. Sexualdeliktes eingeschaltet, wenden diese Methoden an, die Betroffene weiter entmächtigen, erniedrigen und teils retraumatisieren.
Das Patriarchat im Kapitalismus versucht Frauen, trans, inter und nicht-binäre Menschen unsichtbar zu machen, unter sich zu spalten und wiederum zu homogenisieren, wie es gerade notwendig erscheint. So wird das Modell der erfolgreichen Geschäftsfrau als Beispiel genommen, das den Frauen der sogenannten Mittelschicht bis in die besitzende Klasse aufzeigt, dass diese es doch auch schaffen können. Firmen geben sich feministisch, in dem sie ihre Frauenförderung und ihre Frauenquote oder LGBTQ+-Freundlichkeit betonen. Gleichzeitig wird eine klare Linie zwischen den erfolgreichen Frauen und «unerfolgreichen» Frauen, Frauen mit gesellschaftlich als unethisch betrachteten Berufen wie der Sexarbeit und unbezahlten Care-Arbeiterinnen gezogen. Anstatt Gemeinsamkeiten zu erkennen und gegenseitige Unterstützung zu fördern, entstehen neue Gruppen, Missgunst und die vom Patriarchat unterdrückte Gruppe wird gespalten. Bei einigen entsteht die Ansicht, vom Patriarchat und vom Kapitalismus auch profitieren zu können, würden sie sich den gewünschten Normen unterordnen und das patriarchale Spiel des Heraufarbeitens mitspielen.
Weiter müssen wir benennen, dass Frauen, trans, inter und nicht-binäre Menschen, die von Armut betroffen sind, weniger Chancen auf ein sicheres, gewaltarmes Leben haben. Mehr Sicherheit kann durch die Möglichkeit einer eigenen Wohnung, Notschlafstellen ohne cis Männer und finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht werden. Viele Frauen wohnen beispielsweise aus finanzieller Abhängigkeit mit einer gewaltausübenden Person zusammen, obwohl sie andauernd Gewalt erleben und diese eigentlich durchbrechen wollen. In den Medien und auf staatlicher Ebene wird oft vom Stockholmsyndrom gesprochen und die betroffenen Frauen werden verurteilt, weil sie immer wieder zu ihren Peinigern zurückkehren. Hier fehlt eine strukturelle Betrachtungsweise und eine ökonomische Unterstützung, die Gewaltbetroffenen eine Unabhängigkeit garantieren kann.
Der Staat
Die Entwicklung des modernen Staates begann im 16. Jahrhundert während der Reformation. Wegen der religiösen Umwälzungen konnte die politische Macht nicht mehr durch göttliche Macht begründet werden und der Staat begann, sich über eine nationale Erzählung zu rechtfertigen. Mit der Reformation wurde zunehmend politische Macht von religiöser Macht getrennt. Ein Effekt dieser Entwicklung war, dass der Staat sich zunehmend für seine Bürger*innen zu interessieren begann. Die Bewohner*innen des Territoriums wurden erfasst, kategorisiert und besteuert.
Ein weiterer wichtiger Moment beim Aufbau des modernen Staates ist die Französische Revolution. Zwischen der Reformation und der Revolution entstand eine neue Klasse: Das Bürgertum. Obwohl es im Vergleich zu Adel und Klerus (Priesterstand) politisch schwach blieb, stiess es auf günstige Bedingungen für seine wirtschaftliche Entwicklung und wurde immer einflussreicher. Die industrielle Entwicklung vergrösserte die soziale Basis des Bürgertums und führte zu einer gewissen politischen Stärke. Die so angewachsene Macht kollidierte schliesslich mit dem starren feudalen System.
Die Französische Revolution war kein abrupter Bruch. Das Ende der Monarchie und die endgültige Einrichtung eines bürgerlichen Staates stellen einen Prozess dar, der sich über ein ganzes Jahrhundert hinzog. Politische Macht war nun nicht mehr nur eine Frage der Familie und der Vererbung. Der Staat durchdrang die Gesellschaft während dieses Prozesses immer stärker.
Der Staat war aber schon immer ein Instrument der privilegierten Klassen (Klerus, Adel, Bürgertum), um die Gesellschaft zu beherrschen. Der Staat ist deswegen eine von der Gesellschaft getrennte Institution. Er lenkt und verwaltet die Gesellschaft von oben. Ein Element spielt bei dieser Trennung von Staat und Gesellschaft eine wesentliche Rolle: Die Bürokratie. Die Interessen der privilegierten Klassen hinter dem Staat geben ihm die Fähigkeit zur Selbsterhaltung und Selbstentwicklung: Der Staat muss sich an Veränderungen anpassen können, damit die gleichen Machtverhältnisse weiter bestehen können. Und diese Fähigkeit spiegelt sich in der Bildung einer bürokratischen Klasse wider. Um handlungsfähig zu sein, braucht ein Staat also Menschen, deren Interessen eng mit den Interessen des Staates, seiner Erhaltung und Entwicklung verbunden sind. Diese Menschen sind in ihrem beruflichen Handeln und Denken de facto selbst von der Gesellschaft getrennt, weil ihre Interessen mit denen des Staates übereinstimmen. Die Bürokratie ist mit der Staatslogik so stark verbunden, dass sie manchmal mit den Interessen der Kapitalist*innen in Konflikt gerät. Schlimmer noch: Wenn der Staat von den lohnabhängigen Klassen erobert wird, um die soziale und politische Realität umzugestalten, werden die Revolutionär*innen schnell zu einer neuen Bürokratie, die den Staatsinteressen dient. Anders gesagt: Nicht die Revolution erobert den Staat, sondern der Staat erobert die Revolution.
Dies ist ein zentraler Punkt. Der Staat ist kein neutrales Instrument, das von allen gleichermassen benützt werden kann. Der Staat ist ein Herrschaftsinstrument, er kann nur mit privilegierten Klassen funktionieren. Das liegt in seiner Natur. Jeder Versuch, den Staatsapparat als Mittel für eine soziale Umwälzung zu benützen, kann nur scheitern und wird zu neuer Herrschaft führen.
Die Bürokratie hat sich im modernen Staat zu einer politisch-bürokratischen Klasse weiterentwickelt. Bürokrat*innen und Politiker*innen sind zu einem perfekt aufeinander abgestimmten und untereinander austauschbaren Ganzen verschmolzen. Dies gilt für die gesamte politische Klasse, unabhängig davon, ob sie Teil von Militär, Polizei, Parteien oder sozialen Organisationen sind. Auch die am Staat orientierten Funktionär*innen der Zentralgewerkschaften (→ Arbeiter*innenbewegung und Gewerkschaften) sind an den Staat anschlussfähig und können von ihm vereinnahmt werden. Denn kurz gesagt: Sie handeln in der Logik des Staates.
Auch wenn der Staat das von der Gesellschaft getrennte Verwaltungszentrum ist, umfasst er nicht die gesamte Macht. Ein erheblicher Teil der Macht liegt bei den herrschenden Klassen selbst. Der Staat dient ihnen und verteidigt ihre Interessen zwar, sie können und wollen aber trotzdem eine gewisse Autonomie vom Staat bewahren. Dies ist aber nur möglich, weil die herrschenden Klassen ausserhalb der Gesellschaft stehen und deswegen nicht vollständig vom Staat erfasst werden. Die herrschenden Klassen erreichen dies, weil ihr politisches Handeln nicht auf den Staat und seine Logik ausgerichtet ist. Ihnen ist sogar völlig bewusst, dass sie dem Staat nicht gehorchen und seine Regeln nicht akzeptieren dürfen, um ihre Privilegien zu sichern respektive auszubauen.
Der Staat umfasst ausser dem harten Kern, wie Bürokratie und Polizei, auch einen weiteren Einflussbereich: Institutionen ausserhalb der formellen staatlichen Struktur, die eine staatliche Rolle spielen, wie zum Beispiel die zur SBB gehörende Transportpolizei. Und auch der Staat ist keine stabile Institution. Er ist in dem Widerspruch gefangen, ein Herrschaftsinstrument und gleichzeitig auch am Gemeinwohl orientiert zu sein. Der Staat ist sowohl die Schule als auch die Polizei. Er ist das Krankenhaus und das Gericht. Der Staat hat in seiner Fähigkeit zur Selbsterhaltung auch die Macht, sich sehr schnell von einem demokratischen Staat zu einer faschistischen Diktatur oder umgekehrt zu entwickeln, indem er den gesamten staatlichen Einflussbereich aufnehmen, verändern und neu erschaffen kann: Von den zaristischen Offizieren und Bürokraten, die in den Dienst der russischen Revolution traten, bis hin zu Beamt*innen republikanischer Verwaltungen, die in faschistische Verwaltungen wechseln. Dies muss uns als zusätzliche Warnung dienen: Mit dem Staat ist Fortschritt nie endgültig. Alles kann von heute auf morgen rückgängig gemacht werden. Der Staat bindet alles an sich, was in seiner Reichweite liegt.
Jedes Mal, wenn unterdrückte Klassen soziale und politische Fortschritte erzielt haben, geschah dies gegen den Staat und somit die Ordnung, die der Staat zum Nutzen der besitzenden Klassen aufrechterhält. Unsere Klassen erreichen sozialen Fortschritt durch die Direkte Aktion. Fortschritt kann nur unabhängig vom Staat erreicht werden. Unser gesamtes Handeln muss davon ausgehen, dass wir uns unabhängig vom Staat und seiner Logik organisieren. Diese Unabhängigkeit ist absolut grundlegend, denn wenn die Eroberung des Staates ein Ziel bleibt, selbst wenn es nicht das Hauptziel ist, bleibt der Staat immer der Dreh- und Angelpunkt aller Überlegungen. Und deswegen muss auch das politische Handeln mit dem Staat vereinbar sein – der Staat kann nicht gegen den Staat erobert werden.
Wir kämpfen nicht nur in aktivem Gegensatz zum Staat, damit wir vor der Staatslogik geschützt sind, es ist auch eine strategische und grundsätzliche Frage: Es geht für uns nicht nur darum, für die materielle Verbesserung der Lebensbedingungen unserer Klassen zu kämpfen. Es geht auch um einen Kampf für die Abschaffung von Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung. Es geht um den Aufbau einer Welt ohne den Staat, schlussendlich um die Zerstörung des Staates.
Eine staatenlose Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die nicht von oben verwaltet wird, muss sich zwangsläufig selbst verwalten. Direkt, durch sich selbst. Direkte Demokratie und Selbstverwaltung bedeuten nicht, Vertreter*innen der Gesellschaft in eine von der Gesellschaft getrennten Verwaltung zu schicken. Das wäre bloss eine andere Form von Staat. Die Selbstverwaltung muss innerhalb der Gesellschaft selbst stattfinden.
In aktivem Gegensatz zum Staat zu kämpfen, bedeutet auch, innerhalb der Gesellschaft selbst zu kämpfen. Durch Aktion und Organisation in Kämpfen erschaffen wir soziale Stärke und lernen, wie wir die Gesellschaft verändern können. Aktion und Organisation eröffnen aber auch die Möglichkeit für Volksmacht (Poder Popular), also zur Gegenmacht der lohnabhängigen Klassen. Dies ist der Schlüssel zur Zerstörung des Staates. Der Staat wird durch Demontage zerstört. Sich die Vorrechte des Staates anzueignen, seine Kompetenzen zu beschlagnahmen und immer grössere Bereiche selbst zu verwalten – so bauen die Unterdrückten eine neue Welt auf, eine Welt ohne Staat.
Parlamentarismus
Die meisten Menschen in der Schweiz glauben, dass die Gesellschaft nur über Parteien und Parlamente verändert werden kann. Wer sich politisch beteiligt, tut dies meistens innerhalb einer Partei oder eines Initiativ- oder Referendumskomitees. Dies sind Formen des Parlamentarismus, also des parlamentarischen, institutionellen Weges. Dahinter steckt die Idee, dass grundlegende gesellschaftliche Verbesserungen erreicht werden können, wenn genügend Sitze im Parlament gewonnen werden. Dies ist unserer Meinung nach nicht möglich, da auf der einen Seite die Regeln des Parlaments die Parteien dazu zwingen, «Mehrheiten zu schaffen» und somit faule Kompromisse mit politischen Gegner*innen zu schliessen. Auf der anderen Seite braucht es auf dem Weg zur parlamentarischen Mehrheit viel Geld, Beziehungen und (unbezahlte) Arbeitsstunden, welche die lohnabhängigen Klassen nur unter grossem Aufwand aufbringen kann. Dasselbe gilt für die direktdemokratischen Instrumente der Schweiz, also Initiativen und Referenden: Jede Initiative und jedes Referendum brauch enorme Geldsummen, um die nötigen Unterschriften zu sammeln. Dann braucht es Parlamentarier*innen oder Lobbyist*innen, welche Druck aufbauen, damit die Vorlage schnell einen Abstimmungstermin bekommt und zu guter Letzt braucht es enorme Mengen Geld für die Werbung im Abstimmungskampf.
Dieser Aufwand ist aber komplett vergebens, da ein Staat stets nur als Ausdruck der tatsächlichen Kräfteverhältnisse einer Gesellschaft existieren kann (→ Staat). Auch linke Regierungen müssen den Regeln folgen, also zum Beispiel Spardiktate einhalten, um einen Staatsbankrott abzuwehren. Die politischen Parteien sorgen dafür, dass das Funktionieren von Staat und Wirtschaft den immer wieder entstehenden Krisen angepasst werden, damit die Wirtschaft weiterwursteln kann wie bisher.
Die Anliegen von kleineren und/oder weniger (einfluss-)reichen Gesellschaftsgruppen spielen deswegen im Parlament kaum je eine Rolle. Dazu gehören auch diejenigen Gruppen, die in der Vergangenheit oder auch heute noch, aus dem parlamentarischen Prozess ausgeschlossen wurden und werden. Zum Beispiel ist das ein ungefähres Viertel der schweizerischen Bevölkerung, welches sich nicht an allen politischen Entscheidungen beteiligen kann, weil es nicht die schweizerische Staatsbürgerschaft hat. Dass Politik von und für Mächtige gemacht wird, führt aber selten zu grösseren ausser- und antiparlamentarischen sozialen Bewegungen. Stattdessen wechseln die Wähler*innen von einer Partei zur anderen, flüchten in die Passivität oder wenden sich rückwärtsgewandten und autoritären Ideen zu.
Vom Parlament geht eine grosse Gefahr für soziale Bewegung aus: Bewegungen organisieren sich meistens um ein konkretes Problem, das sie gelöst haben wollen. Bietet das Parlament dann eine teilweise oder/und scheinbare Lösung an, kann dies die soziale Bewegung sabotieren. Diejenigen, die von der angebotenen Lösung zu profitieren glauben, werden es sich nämlich gut überlegen, ob sie weiterhin ihre kostbare Freizeit und Energie in die Bewegung stecken. Aber auch wenn wir den Parlamentarismus ablehnen, ist es wichtig zu wissen, was in den Parlamenten passiert. Denn die dort getroffenen Entscheidungen haben immer Auswirkungen auf unser Leben, zum Beispiel wenn Arbeitslosengeld und Prämienverbilligungen gekürzt oder wenn Bussen und Gefängnisstrafen erhöht werden.
Da die parlamentarische Demokratie das Wirtschaftswachstum und die Zufriedenheit des grössten Teils der Bevölkerung nicht dauerhaft unter einen Hut bringen kann, nehmen wir sie nicht als dauerhaft stabil war. Wenn eine Krise der Demokratie entsteht, gibt es zwei Auswege: Autoritarismus, zum Beispiel Faschismus, oder eine Ausweitung von Selbstverwaltung und Selbstbestimmung. Im Hier und Jetzt ist es wahrscheinlicher, dass die Besitzenden in Krisenzeiten auf faschistische Bewegungen und Parteien setzen, da sie sich von diesen einen gewissen Schutz ihres Status erhoffen. Der Faschismus ist dabei aber keine Marionette oder eine Maske des Kapitals. Er ist eine eigene Bewegung mit einer Strategie der parallelen Mobilisierung der Massen und des Kapitals. Dies muss uns bewusst sein und wir müssen uns auf die Gefahr eines starken, eventuell staatsdominierenden Neofaschismus vorbereiten.
Nationalismus
Nation als Begriff kommt ursprünglich aus dem lateinischen nātio und steht für Volk, Sippschaft, Menschenschlag, aber auch Gattung, Klasse, Schar und Geburt. Es bezeichnet grössere Gruppen von Personen, denen gemeinsame Sprache,Tradition, Sitten, Bräuche und Abstammung zugeschrieben werden. Im 19. Jahrhundert wurden bürgerliche Staaten geschaffen, die ihre Legitimität nicht mehr in der Abstammungslinie einer Herrschaftsfamilie finden konnten. Die Legitimität wurde jetzt von einer Nation abgeleitet (→ Staat). Dieser Nation sollte eine Heimstätte gegeben werden: Der Nationalstaat. Das Konzept Nationalstaat sagt aus, dass in einem Land nur eine Nation ansässig ist und jede Nation ihren eigenen Staat haben soll. Der Gedanke, dass eine Nation besser als eine andere ist, entsteht von da schnell und entspricht dem Kern des Nationalismus. Wo eine Nation beginnt und wo eine andere aufhört, ist aber überhaupt nicht einfach und deutlich. Deshalb wurden nationalistische Mythen als vereinendes Element geschaffen. Gemeinsamkeiten werden betont und Unterschiede aktiv unterdrückt. So konnten zum Beispiel Fries*innen und Bayer*innen überhaupt Teile der gleichen Nation werden. Dazu wurden Kultur, Sprache und Tradition vereinheitlicht, also eine Leitkultur konstruiert. Ein Beispiel dafür ist die Erschaffung einer zentralen Hoch- respektive Schriftsprache und der Abwertung der lokalen Sprachen und Dialekte. Diese wurden als rückständig, kleingeistig, verfälscht, bäuerisch und dumm angesehen. Diese Einheit war nicht schon immer da. Im Gegenteil; sie wurde durch den Staat erzwungen.
Staat und Nation werden fälschlicherweise häufig als das Gleiche angesehen. Hier ist zu unterscheiden, dass der Staat, salopp ausgedrückt, die Administration eines Landes übernimmt und die Nation eher die Idee ist, warum ein Staat denn legitim sei und was ihn ausmache. So werden historische Ereignisse zu einer gemeinsamen Geschichte einer Nation geformt, glorreiche Taten der «Ahnen» der Nation werden hochstilisiert, Ereignisse, die dieser Erzählung widersprechen, werden ausgeblendet. Es spielt ebenso keine Rolle, ob diese Ereignisse fiktiv oder real sind. Darin ist die Schweiz mit der Geschichte des Nationalhelden Wilhelm Tell keine Ausnahme. Der Prozess, der beschreibt, wie ein solches Ideenkonstrukt entsteht, wird Nationenbildung genannt. In diesem Prozess werden gemeinsame kulturelle Standards von den Machtzentren aus konstruiert und durchgedrückt. Diese Standarte führen zu einem Leitbild, wie ein Mensch in einem bestimmten nationalstaatlichen Konstrukt sein soll. Es wird also eine kollektive Identität geschaffen, eine Leitkultur. So werden Volkseigenschaften, wie z.B.: «die Schweizer*innen sind pünktliche und fleissige Menschen», gebildet. Dies ist veränderbar, je nachdem in welche Richtung ein gesellschaftlicher Diskurs geht.
Die Individualität der Menschen wird durch eine Einheitsidentität ausgeblendet. Nationale Identität beruht auf Ein- und Ausschluss von Menschen. Der Mensch wird durch Zwang in eine homogene Masse integriert. So sprachen z.B. in den 1870ern 80% der Französ*innen im Alltag eine andere Sprache als Französisch. Viele sprachen überhaupt nicht Französisch, sondern etwa okzitanisch, bretonisch oder frankoprovenzalisch. Somit werden im Prozess der Nationenbildung Teile der Individualität eines Menschen ausgelöscht, wie auch die soziale Position ausgeblendet. Beim Ausschluss von Menschen wird ebenso willkürlich voneinander getrennt, wenn gesagt wird, dass die «Fremden» ganz anders und nicht so wie «wir» seien. Dies führt dazu, Staatsgrenzen als etwas Gutes und «Natürliches» zu akzeptieren, da auf der anderen Seite ja die «Fremden» wohnen würden. Doch sind diese «Anderen» wirklich anders? Die Lebensrealitäten von zwei lohnabhängigen Menschen, die in unterschiedlichen Staaten leben, sind ähnlicher als die Lebensrealitäten zwischen einer Lohnabhängigen und eines Kapitalisten, die in der Schweiz leben (→ Klassen). Die nationale Identität ist ein sehr effektives Werkzeug, um diese Klassengegensätze zu verschleiern.
Deshalb lehnen wir Nationalismus ab, anerkennen aber gleichzeitig das Selbstbestimmungsrecht aller Menschengruppen. Denn keine Sprache, Schrift oder Kultur darf unterdrückt werden. Wir sind bereit, mit allen Menschen gegen ihre Unterdrückung zu kämpfen, beharren gleichzeitig aber gegenüber allen Menschen auf unseren Grundwerten: Unterdrückungsformen sollen überall und immer bekämpft werden.
Kurze Analyse des kapitalistischen Wirtschaftssystems
Wir befinden uns in einer Welt, die fast komplett durch ein einziges Wirtschaftssystem verbunden wird: Dem Kapitalismus. Alle Waren und Dienstleistungen aus Betrieben werden nach kapitalistischen Prinzipien erarbeitet und vertrieben. Sich dem zu entziehen, ist so gut wie unmöglich, denn es müsste alles, was verbraucht wird, selbst hergestellt werden (Medizin, Transportmittel, Unterhaltungsmedien, Kommunikationsmittel, etc.). Es ist deswegen äusserst wichtig, dass wir verstehen, wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert und welche Probleme es mit sich bringt.
Was ist Wirtschaft? Das ist die gesamte Produktion aller Güter und Dienstleistungen sowie deren Verteilung und Verbrauch. Wirtschaft ist der Anbau von Gemüse, dessen Ernte, Lagerung und Transport, dessen Verkauf im Supermarkt (oder Hofladen) und die Gemüsepfanne, die du daraus kochst. Wie das Gemüse angebaut wird, wie und an wen es verteilt wird und zu welchen Bedingungen all dies geschieht, das ist das Wirtschaftssystem.
Das Wirtschaftssystem Kapitalismus heisst so, weil die Anhäufung und Investition von Geldmitteln, also Kapital, das Fundament bildet. Das Kapital soll investiert werden und einen Gewinn abwerfen, damit es wieder investiert werden kann. Dass Gewinn gemacht werden muss, liegt aber nicht an Gier oder Charakterschwäche, sondern daran, dass Kapital nicht einfach für alle da ist. Aufgrund der Konkurrenz zwischen den Kapitalist*innen und der damit verbundenen günstigeren Produktion, der Unterbietung des Preises der Konkurrenz, bis ein Monopol hergestellt wird, müssen die Kapitalist*innen immer weiter investieren. Somit ergibt sich ein Investitionswettbewerb, welcher sich in einen Wachstumszwang der gesamten Wirtschaft äussert, um die Profite zu sichern.
Handel benötigt eine gewisse Sicherheit; du tauschst nicht mit jemandem Gemüse, wenn diese Person sich immer mit deinen Kartoffeln davon macht, ohne dir etwas von ihren Tomaten zu geben. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, braucht der Kapitalismus zwei Dinge: Das Privateigentum und jemanden, der dieses Privateigentum schützt: Der Staat (→ Staat).
Wenn nun das investierte Kapital immer mehr werden muss, dann sammelt sich auch immer mehr bei denen an, die investieren können. Diejenigen, die Kapital haben, nennen wir Kapitalist*innen. Sie besitzen die Güter und die Mittel, um etwas herzustellen – von Boden, über Gebäude und Maschinen bis zu den Rohstoffen, aus denen etwas hergestellt werden kann. All diese Dinge zusammen nennen wir Produktionsmittel. Wer Produktionsmittel hat, kann Arbeiter*innen anstellen, die gegen Lohn Produkte herstellen. Die Arbeiter*innen sind idealerweise – aus der Sicht der Kapitalist*innen – doppelt frei: Frei von Produktionsmitteln und Kapital (sie müssen also einen Lohn bekommen, um zu überleben) und sind frei, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Diese Arbeiter*innen sind also lohnabhängig und damit den Kapitalist*innen ausgeliefert. Sie müssen miteinander um Arbeitsstellen konkurrenzieren. Wenn dieser Konkurrenzkampf gross ist, sinken die Löhne. Während die Lohnabhängigen so hohe Löhne wie möglich wollen, möchten die Kapitalist*innen so tiefe Löhne wie möglich bezahlen, damit sie (höhere) Gewinne einfahren können. Dies ist ein unüberwindbarer Gegensatz im Kapitalismus (→ Klassen).
Die Lohnabhängigen erhalten nur einen kleinen Teil des von ihnen hergestellten Werts als Lohn. Die Differenz zwischen Einnahmen einerseits und Löhnen und Herstellungskosten andererseits ist der Mehrwert. Also das, was die Kapitalist*innen als Belohnung für ihre Investition behalten – als Profit, Aktiendividenden und Zinsen. Dies führt zu einer komischen Lage. Die Mehrheit der Menschen produziert als Lohnabhängige den materiellen Reichtum der Gesellschaft, der Gegenwert dieses materiellen Reichtums bleibt aber bei den kleinen Klassen der Kapitalist*innen.
Produktion und Konsum werden im Kapitalismus über den Markt gesteuert. Das heisst nicht nur die Lohnabhängigen, sondern auch die Unternehmen stehen in Konkurrenz zueinander. Das Kapital muss Profit erwirtschaften, es muss sich verwerten, um auf dem Markt bestehen zu können. Das bedeutet wiederum, dass die Unternehmen einen Teil ihres Gewinns wieder investieren müssen, um ihre Marktanteile zu verteidigen, auszubauen oder neue zu erschliessen. Oder anders gesagt: Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Dies kann verschiedene Formen annehmen wie z.B. neue Konsument*innengruppen erschliessen, (vermeintlich) bessere Produkte anbieten, günstiger produzieren dank günstigeren Produktionstechniken oder durch gesenkte Standort- oder Lohnkosten, Konkurrenzunternehmen aufkaufen oder mit diesen fusionieren. Die beste Taktik für ein Unternehmen, den eigenen Platz zu sichern, ist, wenn es kein anderes Unternehmen gibt, das mithalten kann. Mit anderen Worten: Ein marktbeherrschendes Monopol zu schaffen. Deswegen tendiert der Kapitalismus stets in Richtung Monopole.
In diesem Wirtschaftssystem geht es also nicht zuerst um die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, Gütern und Dienstleistungen, sondern um einen möglichst hohen Profit. Deswegen wird jeder Gegenstand, jede Dienstleistung und auch jeder Mensch auf den möglichen Gewinn untersucht. Dies führt natürlich auch dazu, dass wir uns zu fragen beginnen, ob wir mehr aus uns herausholen können: Weiterbildungen besuchen, Sprachen lernen, Sport machen – unsere Gesellschaft macht dies zunehmend mit dem Ziel der Verbesserung, der Optimierung, und nicht (nur), weil es Freude bereitet oder dem Austausch mit anderen Menschen dient.
Die Ausrichtung auf einen möglichst hohen Profit macht es trotz aller Technologie schwierig, den Hunger zu bekämpfen oder Umweltzerstörung zu verhindern (→ ökologische Krise). Auch wenn Umweltgesetze eingeführt werden: Solange es Schlupflöcher gibt oder sich die Umgehung der Gesetze für die Firmen lohnt, wird es gemacht werden. Der Zwang zum Profit und damit zum Wachstum ist ein Kernmechanismus dieses Wirtschaftssystems, deswegen müssen sowohl Rohstoffe als auch Energie so günstig wie möglich sein.
Der Wachstums- und Profitzwang dieses Wirtschaftssystems hat zwar technologische Neuerungen in einem nie dagewesenen Tempo ermöglicht (von Muskelkraft über Dampf- und Verbrennungsmotor zu Elektronik), aber die negativen Folgen sind enorm: Armut, Zerstörung menschlicher Gemeinschaften, der Umwelt, des Klimas und sogar Kriege. Dies kann nicht als Folge beispielsweise einer fehlenden Moral betrachtet werden, sondern ist die Folge der Logik des kapitalistischen Wirtschaftssystems.
Rassismus und Fremdenhass
Menschen bewerten Menschengruppen seit schriftliche Zeugnisse existieren. Gewisse Menschengruppen wurden geringer bewertet oder ihnen negative Eigenschaften zugeschrieben. Sklaverei ist ebenso lange dokumentiert, allerdingswaren Zugehörigkeiten durchlässiger: Im antiken Rom etwa konnten es Sklav*innen durchaus zu Reichtum und höherem Status bringen – und sie konnten befreit werden und waren dann von römischen Bürger*innen nicht zu unterscheiden. Sklaverei war vielfach auch keine einseitige Angelegenheit: Im Mittelmeer zum Beispiel versklavten sowohl nordafrikanische Korsar*innen Europäer*innen, als auch Europäer*innen Nordafrikaner*innen. Sklaverei istdenn auch keineswegs ein rein europäisches Phänomen, verschiedene Systeme von Sklaverei gab es auf allen Kontinenten: Im vormodernen China zum Beispiel war Sklaverei weit verbreitet, aber durch einen Vertrag definiert und meistens nicht lebenslänglich. In Mauretanien ist die Sklaverei trotz nominellen Verboten bis heute weit verbreitet.
In Europa brachte die Aufklärung paradoxerweise eine Verschlimmerung: Sklaverei wurde jetzt als moralisch schlecht und nicht mehr als neutrale, «natürliche» Gegebenheit angesehen und musste deswegen legitimiert werden. Nicht-europäischen Menschen wurden deswegen ihr Menschsein abgesprochen, um Massenmord, Sklaverei und Ausbeutungzu rechtfertigen. Aber auch die Religion blieb als Rechtfertigung wichtig: (Zwangs-)Missionierte konnten laut damaligem Glauben Erlösung finden, Nicht- oder Falsch-Gläubige hingegen nicht. Der europäische Kolonialismusplünderte ganze Kontinente und verschleppte, entrechtete und ermordete Millionen von Menschen. Die herrschenden Klassen der europäischen Mächte konnten durch die Ausbeutung von Territorien, Ressourcen und Menschen enormeProfite anhäufen. Dieses Kapital stellte eine wichtige Basis für die industrielle Revolution und ermöglichte eine wirtschaftliche Dominanz europäischer Mächte bis ins 20. Jahrhundert (→ Kapitalismus).
Moderner Rassismus ist eine Erfindung des 18. und 19. Jahrhunderts. Es ist ein haarsträubender Versuch, den Vorurteilen eine pseudonaturwissenschaftliche Grundlage zu geben. Die Unwissenschaftlichkeit der Theorien zeigt sich bereits in der Uneinigkeit über die angeblich messerscharfen Grenzen zwischen den Menschengruppen, die teils ganzunterschiedlich eingeordnet und bewertet wurden. Die Rassentheorien sollten rechtfertigen, dass Menschen einen unterschiedlichen Wert zugeschrieben wird: Die weissen Menschen seien demnach entwickelt, zivilisiert, fortschrittlich,mündig. Alle anderen, z. B. Indigene, seien unterentwickelt, unzivilisiert, traditionell, unmündig.
Durch die Verbote der Sklaverei im 19. und 20. Jahrhundert und der Ausweitung kapitalistischer Strukturen mit der Industrialisierung hat sich auch die Funktionsweise von Rassismus weiterentwickelt. Einerseits kann damit versuchtwerden die Einheit der unterdrückten Klassen zu verhindern (→ Klassen), andererseits kann durch die Konstruktion vonanscheinend klar voneinander abgetrennten und in sich homogenen Völkern eine Legitimation für einen Nationalstaat geformt werden (→ Nationalismus).
Nach dem 2. Weltkrieg entstand eine neue Form des Rassismus, der kulturelle Rassismus. Denn die Kategorie «Rasse» war nach der Shoah, der Vernichtung der europäischen Jüd*innen, in Europa nicht mehr tragbar. Es fand eine Verschiebung zum Begriff «Kultur» statt. Beim kulturellen Rassismus wird nicht mehr von biologischen «Rassen» ausgegangen. Stattdessen werden gesellschaftliche Gruppen gebildet, denen aufgrund von Sprache, Religion oder Lebensstil eine gemeinsame «Kultur» oder «Mentalität» zugeschrieben wird. Wie beim biologistischen Rassismus gibt es eine Hierarchie von Höher- und Minderwertigkeit zwischen den «Kulturen», die nicht miteinander vereinbar seien. Das zeigt sich zum Beispiel beim antimuslimischen Rassismus: Es wird eine «islamische Kultur» konstruiert, die patriarchal, rückständig, gewalttätig und nicht mit einer «christlichen Kultur» vereinbar sein könne. Darum sei alles Islamische eine Bedrohung, was zur Rechtfertigung von Kriegen (Afghanistan), rassistischen Gesetzen (Minarettverbot) und Kleidervorschriften (Verbot von Kopftüchern) genutzt wird.
Wie oben angetönt ist Rassismus oft mit Nationalismus verknüpft und nicht nur mit (post-)kolonialen Ideen. Das heisst Rassismus existiert in mehr als einer Form und kommt in allen Teilen der Welt vor, etwa in systematischer Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen aus Simbabwe in Südafrika, der muslimischen Rohingya durch die buddhistischen Bamar, der Afroamerikaner*innen durch Indoamerikaner*innen. Dieses Wissen ist nötig für eine akkurate Analyse, darf aber auf keinen Fall in Whataboutismus enden.
Fremdenhass
Es ist möglich Fremde auszugrenzen, ohne dass dies rassistisch ist. Wir sprechen in diesem Fall von Fremdenhass. Unter Fremdenhass verstehen wir die starke Ablehnung von Personen aufgrund einer subjektiv empfundenen Fremdheit. Fremdenhass kann losgelöst von biologischem Rassismus und (konstruierten) andersartigen Äusserlichkeiten funktionieren. Dem Rassismus gemeinsam ist die Konstruktion von Zugehörigkeit gegen innen und die Ablehnung des Anderen, des Fremden.
Der Fremdenhass ist in der Schweiz tief verankert und existiert neben dem Rassismus. Das beste Beispiel ist wie schon genannt die Ablehnung deutscher Immigrant*innen. Aber auch antiitalienische Ressentiments fallen darunter und die Ablehnung gegenüber Migrant*innen aus dem Balkan. Das bis 2002 bestehende Saisonnier-Statut ist ebenfalls kein rassistisches Gesetz, da es sich primär gegen eine saisonal importierte Arbeiter*innenklasse richtete, die aufgrund von Kontingentsverträgen nur aus spezifischen Ländern aus dem nördlichen Mittelmeerraum kommen konnte (Italien, Spanien, Türkei, Jugoslawien, Portugal).
Im Gegensatz zum Rassismus dessen Hierarchien und Abwertungen oft sehr beständig sind (auch wenn sich die Argumentationen ändern) ist Fremdenhass sehr unbeständig und sehr gut darin ganze Komplexe von Vorurteilen einer neuen Gruppe überzustülpen: Hiess es in der Schweiz lange, dass Italiener faul sind, den Schweizern die Frauen wegnehmen, gewalttätig, auffällig sind und komisch riechen, wurde später diese ganze Sammlung von negativen Bewertungen an Migrant*innen aus Spanien, dann der Türkei, Tamil Eelam und (Ex-)Jugoslawien weitergeben. Die alten «Fremden» wurden im Laufe der Zeit Teil der Mehrheitsgesellschaft ihre Bräuche und Kultur (wie z. B. die Küche) teilweise ins «Eigene» aufgenommen. Sie stiegen in der Gesellschaft auf und waren nicht mehr «nur» entwurzelte Bauarbeiter*innen, Kellner*innen und Köch*innen, sondern wurden (oder zumindest die zweite oder dritte Generation) Kondukteur*innen, (Nati-)Fussballer*innen und Polizist*innen. Die Anstellungschancen mit italienischem Nachnamen stiegen, als die spanischen Namen die neuen Fremden wurden – und deren Chancen stiegen, als die Tamil*innen den schlechten Ruf abbekamen und so weiter. Das Vorurteilspaket ist beständig, aber nicht die damit gemeinte Gruppe. Aktuell sieht es nicht so aus, als würde dieses schnell weitergegeben werden können, da damit zwei Gruppen bedacht werden, bei denen zum Fremdenhass auch noch Rassismus gesellt: Menschen aus dem Maghreb und Westafrika.
Hin zu einer antirassistischen Gesellschaft
Rassismus wird oft ein moralischer Antirassismus entgegengesetzt: Man lehnt die SVP, Nazis und Stammtischparolen ab und sieht sich als Antirassist*in. Doch Antirassismus heisst mehr, als sich gegen rechts zu positionieren. Es geht darum, kollektiv, reflektiert und verantwortungsvoll antirassistisch zu handeln. Dafür müssen eigene und kollektive Denk- und Verhaltensmuster bearbeitet und durchbrochen werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unterstützung und Stärkung der Selbstorganisation der von Rassismus und Fremdenhass betroffenen Menschen. Ihre Autonomie ist unverhandelbar und im Kampf gegen den Rassismus zentral. Gleichzeitig heisst das nicht, dass man keine (solidarische) Kritik äussern darf, nur weil jemand (mehr) von Rassismus betroffen ist. Wir sehen Antirassismus als Teil des Klassenkampfes hin zu einer befreiten Gesellschaft. In sozialen Kämpfen können Brücken geschlagen und Spaltungen überwunden werden. Sei es im Quartier, Betrieb oder in sozialen Bewegungen. So kann Solidarität und Einheit zwischen Ausgebeuteten und Unterdrückten entstehen und Bruchlinien gekittet werden, bevor sie von Staat und herrschenden Klassen ausgenutzt werden können.
Wir sind uns auch bewusst, dass klar voneinander abgrenzbare Völker Konstruktionen sind. Bevölkerungen haben sich auch zu Zeiten der schärfsten Rassentrennungsgesetze vermischt und Gedanken und kulturelle Praktiken regen andere an. Die Zuschreibung von gewissen Ideen und kulturelle Praktiken auf eine ganz bestimmte Gruppe, aber nicht auf deren Nachbar*innen, ist meistens unmöglich. Solche Zuschreibungen, auch wenn sie gut gemeint sind, verstärken unter Umständen sogar das Denken, dass Menschen in scharf voneinander getrennte Gruppen sortierbar sind und deren Handeln aufgrund dieser Zuschreibung gut oder schlecht ist.
Unsere politische Praxis ist in den sozialen Bewegungen der unterdrückten Klassen. In diesen ist auch Rassismus präsent. Als Teil der sozialen Bewegungen verstehen wir unsere antirassistische Arbeit darin, Rassismus und Fremdenhass sichtbar zu machen und zurückzudrängen. Dies kann in Form von Bildungsarbeit, der praktischen Solidarität mit diskriminierten Menschen oder der Förderung von Zusammenarbeit mit antirassistischen Bewegungen geschehen. Rassismus macht auch vor anarchistischen und feministischen Organisationen keinen Halt. Darum setzten wir in unserer politischen Organisation auf kollektives, antirassistisches Handeln. Das heisst, Rassismus und Fremdenhass in der Organisation aktiv zu bekämpfen.
Technik und Technologie
Technik ist weder gut noch schlecht. Sie ist kein Monopol der Menschen und eine Form von Technik gibt es wahrscheinlich seit der Entstehung von Leben – Technik ist Teil der natürlichen Evolution. Für uns ist Technik am einfachsten im Tierreich und dort besonders beim Menschen zu erkennen. Wahrscheinlich greifen aber die meisten Arten auf eine Form von Technik zurück: Zum Beispiel die Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen. Bei Schimpansen lassen sich diesbezüglich sogar kulturelle Unterschiede beobachten. Geier nutzen die Umwelt zum eigenen Vorteil, in dem die Knochen aus grosser Höhe auf ausgewählte spitze Steine fallen lassen, um an das Mark zu kommen. Stachelkopfgräser (Spinifex) in Australien entwickelten Strategien zur Selbstverteidigung gegen andere Arten: Sie reichern Harz an, das sich in der Hitze leicht entzündet. Nach dem Buschbrand wachsen sie schnell nach und können so andere Pflanzen verdrängen.
Es ist also nicht möglich, Technik als ein rein menschliches und von der Natur losgelöstes Phänomen zu betrachten. Die Natur selbst kann weder gut noch böse sein, da sie als Gesamtes keine Absichten verfolgt. Natur ist das Vorhandensein von Leben – sie existiert einfach. Deswegen ist es auch nicht möglich, zwischen guter Natur und schlechter Technik zu unterscheiden. Technik ist also eine gezielte Handlung mittels Hilfsmittel und Strategien. Technologie hingegen ist die Wissenschaft der Technik und der Entwicklung von Techniken. Nach diesen philosophischen Überlegungen ist es für uns jedoch notwendig, die menschliche Technik und Technologie im Rahmen unserer Realität, also der kapitalistischen Gesellschaft, zu betrachten.
Während die meisten Arten Technik nutzen, um das Überleben zu sichern, wird sie in der kapitalistischen Gesellschaft von den herrschenden Klassen genutzt, um Reichtum und Macht anzuhäufen (→ Kapitalismus). Das bedeutet aber nicht, dass in der kapitalistischen Gesellschaft entwickelte Techniken nur deren Interessen dient. Sie kann auch den lohnabhängigen Klassen reale Vorteile bringen: Beispiele dafür gibt es in der Medizin oder bei Hilfsmitteln, wie Rollstühlen, die die Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderungen ermöglichen.
Allerdings werden technologische Fortschritte nicht auf alle Teile der lohnabhängigen Klassen gleich verteilt (→ Klassen). Diese ungleiche Verteilung hat mehrere Gründe: Erfolge sozialer Kämpfe, Machtverhältnisse zwischen Teilen der herrschenden und lohnabhängigen Klassen, die zu einem – in heutiger Zeit instabilen – sozialen Kompromiss und Kolonialismus respektive Imperialismus führen. Nicht nur haben die unterdrückten Klassen ganzer Regionen keinen Zugang zu gewissen Techniken, sondern diese Techniken werden gegen sie angewendet – etwa, um den natürlichen Reichtum ihrer Regionen zu stehlen oder um sie zu beherrschen. Trotzdem sind sie oft an der Entwicklung von Technologien beteiligt. Einschliesslich solcher, die unserer Klasse hier Vorteile bringen.
Die lohnabhängigen Klassen in anderen Regionen sind nicht schlechter gestellt, weil sie keine oder weniger erfolgreiche Kämpfe führen, sondern weil die Klasse der Kapitalist*innen, dank (Neo-)Kolonialismus und Imperialismus unendlich viel brutaler in der Ausbeutung und Beherrschung dieser Menschen vorgehen kann. Dies ist im Zusammenhang von Technologie wichtig, denn die Dominanz, ja das Monopol, der herrschenden Klassen über die Technologie ermöglicht erst die weltumspannende Unterdrückung. Solidarität über Landesgrenzen hinweg ist deswegen absolut notwendig, um die Menschheit vollständig zu befreien.
Die technologische Entwicklung wird nicht durch unsere Klasse bestimmt, obwohl wir es sind, die produzieren. Während wir eine grosse durch die herrschenden Klassen verursachte Umweltkrise erleben, versucht der Kapitalismus, technische Lösungen zur Bewältigung dieser Krise durchzusetzen (→ ökologische Krise). Wir müssen uns bewusst sein, dass so keine Antwort auf die Klimakrise gefunden werden kann, die den lohnabhängigen Klassen, also der Mehrheit der Menschheit, zugutekommt. Denn die kapitalistische Klasse möchte so spät wie möglich eingreifen und nur so wenig retten, wie für die Aufrechterhaltung von Ausbeutung und Herrschaft notwendig ist. Um ein etwas dystopisches Beispiel zu nehmen: Der Kapitalismus geht nicht zugrunde, wenn nur ein paar hundert Millionen Menschen in einer Bunkerwelt unter der Erdoberfläche überleben. Dieses Szenario schreckt daher die radikalsten und zynischsten Teile der herrschenden Klasse nicht ab.
Technologie wird deshalb vor allem entlang von zwei Achsen entwickelt: Die erste ist die hauptsächlich ideologische Entwicklung eines grünen Tech-Kapitalismus, der, sobald die unsichtbare Hand des Marktes gezaubert habe, nach und nach den fossilen Kapitalismus ablösen solle. Das zweite, sehr materielle Ziel ist die weitere technologische Beschleunigung der Anhäufung von Kapital und Ausbeutung. Dieselben Techniken könnten natürlich auch eingesetzt werden, um die menschliche Wirtschaft bei der Verwaltung von Ressourcen zu unterstützen, ganze Regionen zu entgiften und die Produktion und Verteilung entsprechend den Bedürfnissen zu rationalisieren.
Dass die Entwicklung von Technologien nicht entlang von Bedürfnissen der Gesellschaft, sondern denen des Kapitals erfolgt, zeigt das Beispiel des mobilen Internets: Der heutige Entwicklungsstand könnte bereits viele Herausforderungen bewältigen, vor denen eine bedürfnisorientierte Wirtschaft inmitten der Klimakrise stehen würde. Da die kapitalistische Wirtschaft aber unter ständigem Druck steht, gesättigte Märkte durch neu geschaffene Bedürfnisse auszugleichen, wird eine neue Technologiestufe mobilen Internets eingeführt, die noch mehr Ressourcen benötigt und noch umweltschädlicher ist. Für die nächste Technologiestufe müssen tausende Satelliten in die Umlaufbahn gebracht und noch mehr Rohstoffe und Strom verbraucht werden.
Wir müssen unseren Kampf daher auf die Fragen der gesellschaftlichen Nützlichkeit von Technologien, auf deren Produktion und Verteilung ausrichten. Die Kampforganisationen der lohnabhängigen Klassen müssen klären, worin der gesellschaftliche Nutzen von (materiellen oder immateriellen) Produkten besteht, wobei sie die Falle einer moralistischen Romantik (also Konsumkritik) vermeiden müssen (→ Arbeiter*innenbewegung und Gewerkschaften). Und kämpfen, um neue Produktions- und Verteilungsprozesse durchzusetzen.
Es ist auch nötig, die Technologie zu demokratisieren. Wir befinden uns nicht nur in einer Situation, in der die herrschenden Klassen die technologische Ausrichtung unserer Gesellschaft kontrollieren, sondern auch in einer Situation, in der das technische Verständnis einer gebildeten Elite vorbehalten ist. Sicherlich, je komplexer eine Technik ist, desto mehr ist ihre Nutzung einer kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten, die über das notwendige Wissen verfügen. Doch auch wenn technisches Wissen heute häufig in Herrschaft mündet, muss dies in einer befreiten Gesellschaft nicht zwangsläufig so sein.
Der Weg zu einer sozialistischen und libertären Nutzung von Technik und damit auch zum Schutz unserer Umwelt führt über den Aufbau starker und demokratischer Kampforganisationen, die alle Aspekte der sozialen Realität erfassen und berücksichtigen.
Ökologische Krise
Noch keine Krise in der Geschichte der Menschheit hatte potenziell so existenzielle Folgen: Die Tatsache, dass unsere Lebensgrundlage zu grossen Teilen zerstört werden könnte, bedroht das Leben aller Arten. Die Folgen dieser menschenverursachten Veränderungen sind bereits spürbar und sie werden in den kommenden Jahrzehnten enorm verstärkt werden. Das Eintreten von sogenannten Kippelementen könnte die Klimaerhitzung beschleunigen und unumkehrbar machen:
- Permafrostboden bedeckt weltweit mehrere Millionen Quadratkilometer Fläche. Taut er auf, gelangen Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre, also doppelt so viel, wie derzeit in der Luft ist. Durch den aufgetauten Boden wird auch mehr Methan frei, da Bakterien Pflanzenreste im Boden zersetzen.
- Der Amazonasregenwald kann durch die steigenden Temperaturen in Hitzestress geraten: Er verdunstet mehr Wasser, trocknet aus und stirbt. Dann wird der ganze von ihm gespeicherte Kohlenstoff frei.
- Die Wälder der Taiga können durch die steigenden Temperaturen vermehrt Pilzbefall sowie Waldbränden ausgesetzt sein: Auch dadurch wird viel gespeicherter Kohlenstoff frei.
Die Folge dieser drei Beispiele wäre wiederum ein verstärkter Anstieg der Temperatur auf der Erde – es handelt sich folglich um einen sich selbst verstärkenden Kreislauf. Damit wird der Handlungsspielraum der unterdrückten Klassen, sich eine lebenswerte Zukunft zu erkämpfen, immer kleiner. Zudem ist die Klimakrise vermehrt Auslöser vieler inter- und innerstaatlicher Krisen und Gewalt. Je länger mit einschneidenden Massnahmen gewartet wird, desto heftiger werden diese sein müssen und unsere Freiheitsrechte könnten in Folge massiv beschnitten werden.
Die Tatsache, dass Massnahmen notwendig sind, wird durch die Auswirkungen der Krise offensichtlich: Dürren und Überflutungen werden häufiger und stärker, was zu Hunger und einer Verschiebung der Vegetationszonen führen kann. Hinzu kommt, dass durch die Veränderung der chemischen Zusammensetzung des Meerwassers (Übersäuerung) die Ozeane kaum mehr Leben bergen können. Die Kühlgrenztemperatur – die Fähigkeit zur Regulation von Hitze durch den menschlichen Körper – wird zum kritischen Mass für die Bewohnbarkeit weiter Gebiete auf dem Globus. So werden durch eine ungebremste Erwärmung unseres Planeten weite Teile Indiens, des Amazonas-Beckens, grosse Teile Afrikas und Australiens sowie der Südwesten der USA unbewohnbar bzw. ein Überleben in diesen Gebieten unmöglich. Eine Erwärmung von mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau bedeutet also, dass ein Grossteil der Landmasse der Erde Halbwüste und Wüste wird. Infolgedessen können so vermehrt bewaffnete Konflikte um fehlende Ressourcen wie Wasser, fruchtbaren Boden, Nahrungsmittel oder bewohnbaren Lebensraum auftreten.
Auch in der Schweiz werden wir Konsequenzen eines veränderten Klimas erleben: Es wird höhere Temperaturen sowie vermehrt Extremwetter-Ereignisse geben, worunter sowohl die Gesundheit als auch die teure und anfällige Infrastruktur leiden werden. Taut der Permafrost in den Alpen auf, können ganze Täler unbewohnbar werden.
Die Schuld an der Zerstörung unserer Lebensgrundlage trägt der Kapitalismus (→ Kapitalismus). Die heutige Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft verbraucht enorm viel Energie, die aus natürlichen Ressourcen gewonnen wird. Um in diesem System überleben zu können, sind Firmen darauf angewiesen, diese Energie möglichst billig zu erhalten. Die kostengünstigste Energie wird aus fossilen Ressourcen gewonnen, beispielsweise Kohle oder Erdöl. Wie schlimm die Nutzung und Förderung fossiler Energien ist, wird durch folgende Tatsache verdeutlicht: 90 Konzerne, insbesondere im Erdöl-, Gas- oder Kohle-Sektor, verursachen ca. 2/3 aller CO2-Emissionen auf der Erde.
Es stellt sich nun die Frage, weshalb die klimaschädlichsten Energien auch die billigsten sind. Dies soll mit einem vereinfachten Beispiel erklärt werden: Das Grundproblem ist, dass in der kapitalistischen Wirtschaftsweise die Natur keinen Wert hat. Das ist so, weil sie ihre Ansprüche gegenüber den Unternehmen nicht geltend machen kann. Klimaanwält*innen, die die Interessen der Natur vor Gerichten vertreten, sind dafür aber keine Lösung. Denn es ändert nichts am ständigem Wachstumszwang, welcher der kapitalistischen Wirtschaftsordnung eigen ist. Dieser Zwang lässt kommerziell nicht verwertbaren Gütern und Flächen keinen Raum. Dies würde eine «unberührte» Natur aber fordern. Nur weil das kapitalistische System davon profitiert, wird in ihm der Natur und ihren Ressourcen kein materieller Wert zugewiesen. Dieser entsteht erst mit ihrer Förderung und Weiterverarbeitung. Der materielle Wert äussert sich im Geld, das für ein Produkt bezahlt wird. Beispielsweise ist der Fischfang auf hoher See (also weit weg jeglicher Küsten und damit verbundener Staatsansprüche auf das Meer) kaum reglementiert. Ein Fischereiunternehmen kann in diesen Gewässern praktisch gratis fischen, und seinen Fang anschliessend verkaufen. Gleichzeitig muss das Unternehmen der Natur für die entnommenen Fische keine Gegenleistung erbringen. Auf der einen Seite kann sich dadurch ein Unternehmen bereichern, während auf der anderen Seite der von den Fischen geleistete Nutzen für das Ökosystem verloren geht. Für die Schäden an der Natur müssen deren Verursacher also nur in geringem Ausmass bezahlen.
Gleichzeitig ist aber die Nachfrage nach natürlichen Ressourcen enorm gross, weil sie das kapitalistische Verständnis von Fortschritt und Entwicklung, also Wachstum, ermöglichen. Dieses Zusammenspiel von geringen Kosten und hoher Nachfrage führt somit zu einer unkontrollierten Ausbeutung der Erde. Dieses Problem kann aber nicht einfach mit Ausbeutung gegen Bezahlung gelöst werden, was nach kapitalistischer Logik die Antwort wäre. Das Problem liegt im kapitalistischen Verständnis der Natur, nämlich dass sie überhaupt ausgebeutet werden darf.
Als Lösung für die Klimakrise schlägt die herrschende Klasse nun den Green New Deal vor: Mit Technologie und Effizienzsteigerungen soll Energie gespart werden, damit der energieintensive Lebensstil in den westlichen Industriestaaten sowie der globalen Oberschicht beibehalten werden kann. Jedoch sind nur fossile, klimaschädliche Energieträger in der Lage, dies zu ermöglichen. Erneuerbare Energien haben dieses Potential nicht. Auch neue Effizienzsteigerungen bieten keine Lösung des Problems, denn die wesentlichen Einsparungen wurden in den letzten Jahrzehnten bereits erreicht. Der Green New Deal ist somit ein kapitalistisches Versprechen, dass die grundsätzlichen Erwartungen an eine lebenswerte Zukunft nicht wird erfüllen können.
Die Zerstörung der Natur ist global ungleich verteilt. Ärmere Gebiete in südlichen Weltregionen sind viel stärker von der Ausbeutung der Böden, Fischbestände und Wälder betroffen. Ursachen sind der globale Kapitalismus und mit ihm verbundene (neo-)koloniale Abhängigkeitsverhältnisse. Das Kapital wurde und wird gewaltvoll von den Wirtschaftsmächten in den Industriestaaten angehäuft. Die Ausbeutung von Ressourcen wird in wirtschaftlich abhängige Weltregionen ausgelagert. Dort werden weiterhin und vermehrt Menschen von sozialer Sicherheit und Wohlstand ausgeschlossen. Von Klimaveränderungen ausgelöste Fluchtbewegungen nehmen seit Jahren stetig zu.
Die ökologische Frage wird also durch ihre Konsequenzen zur dringendsten Frage, global und existenziell für die Menschheit und unseren Planeten. Angesichts der Klimakrise ist deshalb ein globales Denken unvermeidbar. Wir wollen eine weltweite Klimagerechtigkeit erreichen: Massnahmen gegen die Klimakrise müssen soziale Ungleichheiten bekämpfen und die Hauptverursacher*innen dieser Krise sind für die Schäden haftbar zu machen.
Nach dem heutigen Wissensstand könnten folgende Reformen bereits heute angegangen werden: Eine Vermeidung der fossilen Brennstoffe, eine starke Reduzierung des Flugverkehrs sowie der Grossschifffahrt (Fracht- und Kreuzfahrtschiffe), eine schrittweise Abschaffung der Massentierhaltung und der industriellen Landwirtschaft sowie eine Förderung der ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft.
Doch Reformen allein reichen nicht, um weltweit allen Menschen soziale und demokratische Nutzungsrechte an einer intakten und sich erneuerbaren Natur einzuräumen. Es braucht einen radikalen Bruch mit den bestehenden kapitalistischen und (neo-)kolonialen Verhältnissen. Die unterdrückten Klassen müssen sich in einem global geführten, ökologischen Klassenkampf gegen die herrschenden Klassen und ihre Unternehmen durchsetzen. Aktionsmittel können Streiks, Betriebsbesetzungen, Blockaden oder Sabotage sein mit dem Ziel, sich die Produktionsmittel kollektiv anzueignen.
Der globalen Klimakrise muss eine dezentrale Bedarfswirtschaft entgegengesetzt werden. Die Planung einer ökologischen und sozialen Wirtschaft erfordert in allen Phasen ein hohes Mass der Beteiligung aller Betroffener. Die Planung muss basisdemokratisch von unten nach oben organisiert sein, um sozial und nachhaltig funktionieren zu können. Das Ziel ist eine lokal-regionale demokratische Ökonomie, die autonom und föderal organisiert werden kann. Diese muss auf der Grundlage ihrer natürlichen Ressourcen und der Tragbarkeit der Natur arbeiten und an Stelle der globalisierten Wirtschaft mit langen Transportwegen und starker Arbeitsteilung die Bedürfnisse der Menschen nachhaltig erfüllen. Dennoch muss ein gewisser globaler Austausch stattfinden, weil nicht alle Rohmaterialien überall auf der Erde verfügbar sind. Die Verteilung dieser Rohmaterialien muss auf globaler solidarischer Basis geschehen.
Wir wollen ein hohes Mass an Selbstversorgung, vor allem durch eine ökologische Landwirtschaft: Kollektiv bewirtschaftet, nimmt sie auch nach aussen solidarisch an einer nachhaltigen Welt teil und arbeitet föderal in übergeordneten Strukturen aktiv mit.
Bildung
Bildung an sich ist gut und wichtig. Das aktuelle Bildungssystem aber muss den Anforderungen von Staat und dem jetzigen Wirtschaftssystem gerecht werden und ist deswegen nicht am Menschen orientiert. Bildung als lustvolles, selbstbestimmtes Lernen und Wissensvermittlung sind wichtige Bestandteile einer Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen. Die Zugänge dazu sollen möglichst niederschwellig sein und Bildungsangebote sollen für alle entsprechend ihren Interessen und Fähigkeiten nutzbar werden. Im Hier und Jetzt sind aber auch Bildungsmöglichkeiten wichtig, welche zu einer Verbesserung der jeweiligen Situation verhelfen.
Schulen sind wichtige Säulen des herrschenden kapitalistischen Systems (→ Kapitalismus) und somit ein Ort des Klassenkampfes: Dies gilt sowohl für den emanzipatorischen Kampf von Minderheiten, für den Arbeitskampf von Lehrpersonen wie auch für den Kampf gegen ein überholtes System (→ Arbeiter*innenbewegung und Gewerkschaften). Denn der Einfluss der liberalen Ideologie, welche mittels neuer Lehrpläne eine Output-orientierte Schule anstrebt, um möglichst viele neue Arbeiter*innen zu formen, nimmt immer noch zu. Die Institution Schule reproduziert die herrschenden Verhältnisse, sie hemmt die Emanzipation durch Anpassung und vertieft weiter Irrtümer und Vorurteile. Denn eine Schule ist auch ein Spiegel der Gesellschaft – soziale Hierarchien und Unterschiede spielen genauso eine Rolle, wie ausserhalb der Schule und werden den Schüler*innen auf mehr oder weniger subtile Art eingetrichtert: Trotz der Verankerung im Lehrplan spielt selbständiges Handeln und kritisches Denken nur auf den höheren Stufen des Bildungssystems eine gewisse Rolle, während es auf den tieferen Stufen eher darum geht, dass Autoritäten nicht hinterfragt werden sollten. Der Staat lässt also durch die Erziehung seine Autorität festigen und die Schüler*innen zu «mündigen» Bürger*innen bilden. Dabei werden Normen und Bildungskonzepte vermittelt, die kaum Musse und Freude am Lernen zulassen.
Die Schule als Institution darf als Ort der Erziehung also nicht unpolitisch sein, sondern soll ein Ort der Debatte sein. Angesichts der Klimakrise und der immer grösser werdenden Ungleichheit, sollte die Schule neuen Generationen eine Perspektive aufzeigen. Lehrpersonen bringen eigene pädagogische Werte und Haltungen mit, doch im Bildungssystem darf aber nicht von der staatlichen und kapitalistischen Ideologie abgewichen werden – was als politische Neutralität verkauft wird.
Das kapitalistische Bildungssystem hat den Zweck, dass eine Ordnung aufrechterhalten wird, durch die Verwendung subtiler Methoden von Gewalt wie Strafe und öffentliche Demütigung. Die Schule stellt für viele Kinder und Jugendliche den Ort dar, in der sie erste Herrschaftserfahrungen machen und hierarchische Kommunikation in einer undemokratischen Form erleben. Durch Auswahl und Leistung wird eine Differenz, eine Ungleichheit geschaffen, welche bisherige bürgerliche Werte und ein «System» an nächste Generationen weitergibt, ohne kritisches Denken in und an diesen zu vermitteln. Die Schule verteidigt zwei Monopole: Ein Monopol an Wissen, mit Lehrplänen und Zwangscharakter, das so hemmend auf das selbstbestimmte Lernen und die emanzipatorische Bildung wirkt, sowie ein Monopol an Autorität und Einfluss auf die Zukunft. Die Belehrung geschieht systematisch, kollektiv und geplant. Durch Erfolg im Bildungssystem erhalten Menschen eine Wertzuschreibung innerhalb des nicht sehr durchlässigen Systems (z. B., dass ein*e Realschüler*in nicht Ärzt*in werden kann), die klar abzulehnen ist.
In ganz Europa wird regelmässig der Bildungsstand der Schüler*innen eines Landes erfasst. Die Resultate dieser Pisa-Studie genannten Untersuchungen zeigen, dass von Chancengleichheit oder Bildungsgerechtigkeit nicht gesprochen werden kann: Durch die Klassenzugehörigkeit der Eltern bzw. deren wirtschaftliches Einkommen und erreichte Bildung kommt es zu Ungleichheit (→ Klassen). Je mehr Zeit pro Tag alle Kinder in der Schule sind, desto geringer sind die Bildungsunterschiede als Folge ihres sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Hintergrundes. Dieser ist somit weniger prägend und wird ausgeglichen. Kollektive Erziehung kann mehr Gleichheit und auch gemeinschaftliche Werte fördern.
Die Ungerechtigkeit in den Schulen der Schweiz wird noch stärker durch die geplante, aber nicht umgesetzte Inklusion: Inklusion meint als Idee, dass eine Schule für alle geschaffen werden soll, die niemanden mehr ausgrenzt und so auch Kinder mit einer Behinderung den Zugang zur Gesellschaft ermöglicht und nicht in Sonderschulen «isoliert». Menschen mit einer gewissen Beeinträchtigung können, obwohl die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und die Behindertengleichstellung in der Verfassung verankert hat, nicht in öffentliche Schulen gehen und erleben keine Behandlung im Sinne der ihnen garantierten Menschenrechte. Sonderschulen gibt es weiterhin ebenso wie Kleinklassen. Die Ausgrenzung hat in der Bildung immer noch System.
Die Bildungsungerechtigkeit wird auch durch die Sparpolitik der Gemeinden und Kantonen in Bildungs- und Sozialwesen verschärft: Geldmangel führt zu vermindertem Zugang zu Schulmaterial und Medien, Infrastruktur und schlicht Bildungsmöglichkeiten wie Schulreisen oder Kulturangebote. Durch den Kürzungsdruck der Politik werden Schulen gezwungen, die Bildungsgerechtigkeit zu ignorieren und die Ungleichheiten der Klassengesellschaft werden so auch in Zukunft weiter bestehen und an zukünftige Generationen weitergegeben.
Die Antwort der Wirtschaftsliberalen und Bürgerlichen auf diese Missstände ist die private Schule, welche sich aber nur Reiche leisten können, welche also die Ungleichheit weiter verstärkt. Bildung ist aber ein wesentlicher Teil auf dem Weg zu einer befreiten Gesellschaft. Mit breiter, kritischer Bildung können sich Individuen verändern und diese die Gesellschaft als Ganzes. Bildung ist also grundlegend betrachtet nicht schlecht, sondern eine Grundlage für eine bessere, solidarische und demokratischere Gesellschaft
Bildung soll die Emanzipation und Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen fördern, damit diese ihre eigene Zukunft als freie Persönlichkeiten kritisch, solidarisch und ökologisch mitgestalten können. Gesellschaftliche Ungleichheiten dürfen nicht als persönliche Defizite erlebt werden. Pädagogik darf niemals ein Ausdruck von Herrschaft sein, durch die bürgerliche und kapitalistische Werte und Massstäbe vorgegeben werden. Dem vorherrschenden Konzept von Bildung muss eine emanzipatorische und klassenkämpferische Antwort entgegengesetzt werden, welche die Bedingungen für Bildung nachhaltig verändert. Bildung ist ein Recht, das kollektiv erstritten werden muss.
2. Zukunft entwerfen
Anarchokommunismus
Der anarchistische Kommunismus ist ein Ideengebilde, welches von unzähligen Kämpfenden aus allen Erdteilen geformt und ergänzt wurde. Es handelt sich dabei um eine eigenständige Strömung. Die meisten Menschen, die sich als Anarchist *innen verstanden, fühlten sich dem anarchistischen Kommunismus zugehörig, von Syndikalist*innen bis Insurrektionalist*innen. Der anarchistische Kommunismus ist aber kein starres und unveränderbares Konzept. Solange es den anarchistischen Kommunismus gibt, muss und wird er sich weiterentwickeln. Denn er ist eine Ideologie, die aufgrund der Analyse der uns umgebenden sozialen Verhältnisse entstand und eine Alternative dazu entwerfen will. Wenn sich neue Erkenntnisse eröffnen, neue Ausbeutungsmechanismen aufgedeckt werden, müssen diese in unsere Analyse und Perspektive eingebaut werden. Damit aber festgestellt werden kann, wie die Welt beschaffen ist, müssen wir eine Methode haben, um die realen Verhältnisse zu erfassen und zu messen. Wir verlassen uns bei der Analyse der ökonomischen und gesellschaftlichen Zustände nicht auf unser Gefühl, sondern versuchen das Bestehende empirisch zu erfassen. Das heisst, dass wir unsere Analyse der Welt so weit auf möglichst messbare Faktoren stützen, wir uns also mit dem Materiellen befassen. Folglich stehen wir der wissenschaftlichen Methoden und der Wissenschaft an sich nicht ablehnend gegenüber, sondern sehen sie als ein wichtiges Werkzeug, um die Welt zu verstehen und daraus Schlüsse zu ziehen, um sie selbstbestimmter zu gestalten.
Selbstbestimmung heisst Freiheit. Freiheit auf individueller Ebene heisst: Alles, was mich selbst betrifft, kann ich auch selbst bestimmen. Damit meinen wir zum Beispiel Körperschmuck oder einen Kleidungsstil. So darf mir keine Person verbieten, welchen Haarschnitt ich habe, da diese Entscheidung keine andere Person betrifft. Sobald ich aber etwas machen möchte, was andere Menschen auch betrifft, müssen diese Personen bei dieser Angelegenheit in die Entscheidung miteinbezogen werden. Somit wollen wir Freiheit kollektiv denken. Um dem in der Gesellschaft lebenden Individuum so viel Freiheit, also Selbstbestimmung, wie möglich zu erlauben, braucht es basisdemokratische Strukturen.
Der anarchistische Kommunismus strebt eine komplette Selbstorganisation der Menschen durch demokratische Rätestrukturen an. Das heisst, dass die Entscheidungen immer von unten nach oben getroffen werden. Die Gemeinden oder Kommunen sind mit anderen Gemeinden föderiert, da Arbeitsteilung und Austausch von Gütern Mangel vermeidet oder gar Luxus ermöglicht. Um auf föderaler Ebene zu entscheiden, werden bei tagtäglichen Entscheidungen keine Menschen aufgrund ihres politischen Profils gewählt werden, sondern Delegierte mit einem imperativen, also klar definierten und jederzeit widerrufbaren, Mandat auf die nächste Föderationsstufe geschickt, um die Entscheidungen der Basis zu vertreten. Durch die verschiedenen Ebenen der Föderation können Entscheidungen getroffen werden, die überregional, kontinental oder sogar global gemacht werden müssen. Entscheidungsberechtigt sind alle Menschen, die von der Entscheidung betroffen sind.
Freiheit entsteht aber nicht nur dadurch, dass Menschen das politische Geschick von unten nach oben steuern können: Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind mit den politischen verstrickt und müssen genauso demokratisiert werden. Deswegen streben wir eine selbstverwaltete Wirtschaft an. Dies beginnt auf der untersten Ebene, im Betrieb. Die Arbeiter*innen in einem Betrieb sind alle gleichberechtigt und dürfen sich an den Entscheidungsfindungen im Betrieb beteiligen. Die Betriebe wiederum gehören der ganzen Gesellschaft und stehen nicht in Konkurrenz zueinander. So soll ein solidarisches und ökologisches Wirtschaftssystem geschaffen werden. Die Betriebe haben die Aufgabe so viele Güter zu produzieren, wie benötigt werden, um allen die materiellen Voraussetzungen für ein gutes Leben zu geben. Die einzelnen Arbeiter*innen sind nicht mehr abhängig vom monatlichen Lohn, sondern gehen arbeiten, da sie von der Arbeit aller profitieren und nur durch Arbeit, nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten, an der gesellschaftlichen Produktion teilhaben können. Der Zugang zu Lebensmitteln, Wohnraum, medizinischer Versorgung und Bildung soll frei verfügbar sein, ganz nach dem Grundsatz: Alle nach ihren Fähigkeiten, allen nach ihren Bedürfnissen.
Der anarchistische Kommunismus strebt also eine vom Staat befreite (→ Staat) klassenlose Gesellschaft an (→ Klassen), in der der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit überwunden wurde (→ Kapitalismus), genauso wie andere strukturellen Unterdrückungsmechanismen wie z.B. Rassismus (→ Rassismus), Sexismus (→ Patriarchat), Trans- oder Homofeindlichkeit. Ein erfolgreicher sozialrevolutionärer Prozess, in dem die herrschende Klasse entmachtet wird, schafft aber nicht über Nacht eine klassenlose Gesellschaft. Die Kultur des Kapitalismus und auch alle anderen Unterdrückungsformen werden wir wohl leider weiter in die neue Gesellschaft hineintragen. Diese müssen fortlaufen aufgearbeitet und bekämpft werden. Der Anarchokommunismus formuliert zwar ein Ziel einer erstrebenswerten Gesellschaft, er ist aber weitaus mehr: Er ist eine Art der Analyse und Praxis, eine Wertehaltung und formt ein Menschenbild. Ein positives Menschenbild, welches sagt, dass eine gerechte und selbstbestimmte Gesellschaft mit heutigen Menschen möglich ist, da der Mensch ein empathisches Wesen sein kann, wenn die Bedingungen gegeben sind, um ebendiese Empathie und Gemeinschaftsgeist zu entwickeln.
Feminismus
In den 1970er Jahren entstand in den USA als Abgrenzung zum bürgerlichen Feminismus der Anarchafeminismus. Seit dann hat sich eine anarchafeministische Praxis entwickelt und verbreitet, die Theorie aber eher weniger. Dazu kommt, dass es verschiedene Anarchafeminismen gibt, weil sie auf verschiedenen anarchistischen Strömungen aufbauen. Wir definieren unseren Feminismus ausgehend von einer anarchokommunistischen Grundlage (→ Anarchokommunismus). Wird der Anarchafeminismus allerdings von einer anderen anarchistischen Strömung definiert, ist damit möglicherweise etwas anderes gemeint.
Unser Feminismus ist die radikale Haltung, die eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen und ökonomischen patriarchalen Normen anstrebt. Im weitesten Sinne geht es darum, Unterdrückung und Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes und der sexuellen Orientierung aufzulösen, also hat unser Feminismus die Befreiung und Gleichberechtigung aller Menschen jeglichen Geschlechts zum Ziel. Unser Ziel ist es nicht, dass Frauen und queere Menschen in Macht- oder Kaderpositionen gelangen oder Präsident*innen werden. Wir wollen vielmehr keine Herrschaft, keine Firmenchef*innen und keine Präsident*innen. Wir wollen also die Gesellschaft so umstrukturieren, dass es keine Unterdrückung mehr gibt.
Ein Element des Anarchafeminismus ist der Kampf für befreite Liebe und Sexualität, entgegen patriarchaler Vorstellungen davon (→ Patriarchat). Die Annahme beispielsweise, dass eine Liebesbeziehung ausschliesslich für genau eine Frau und genau einen Mann bestimmt ist, steht sämtlichen libertären Idealen entgegen und stellt eine Unterdrückung von homo-, bi-, pan- und asexuelle Menschen dar. Deswegen kämpfen wir für einen Feminismus, der für die Befreiung aller Geschlechter einsteht. Damit meinen wir, dass wir eine binäre Geschlechterordnung, sprich einer Einteilung in die zwei Geschlechter «männlich» und «weiblich», ablehnen. Wir gehen davon aus, dass diese Einteilung sozial konstruiert ist, jedoch nicht der real existierenden Geschlechtervielfalt entspricht. So bestehen andere Geschlechter zwischen und jenseits der binären Geschlechterteilung. So anerkennen wir die Wichtigkeit, dass wir im Kampf für Feminismus immer für trans, inter und nicht-binäre Menschen kämpfen. Unser Kampf für Feminismus richtet sich gegen jegliche patriarchalen, sexistischen, machoiden, transfeindlichen und homofeindlichen Strukturen. Die klare Unterstützung, Solidarität und Empowerment von Menschen, die sich nicht in der strukturell privilegierten Rolle als cis Mann befinden, gehören für uns zu den wichtigsten Bedingungen für ein gutes Leben, wie wir es wollen. Klassenkampf (→ Klassen) und der Kampf gegen das Patriarchat sind zwei sich bedingende Faktoren, da Frauen, Transpersonen, inter und nicht-binäre Menschen auf mehrfache Weise ausgebeutet werden.
Es soll unser Ziel sein, das verhärtete System von Produktion und der Reproduktion anzuprangern und aufzubrechen (→ Kapitalismus). Auch heute noch ist Arbeit als solche nur anerkannt, wenn sie mit Lohn entschädigt wird. Allerdings wird in unserem System vor allem produktive Arbeit entlohnt, die zudem noch soziale Anerkennung, Selbstwertgefühl und Beziehungen bringt. Dies ist eine Folge der bürgerlichen Illusion, dass der Mann die Familie ernähren soll. Aufgrund der prekären Löhne ist dies für viele Familien keine Option, weshalb sich auch andere Familienmitglieder am Einkommen beteiligen müssen. Also auch wenn die prestigeträchtigen Stellen meist mit cis Männern besetzt werden, leisten alle Geschlechter Lohnarbeit. Die Folge davon ist eine Doppelbelastung für alle diejenigen, die neben der Lohnarbeit auch noch reproduktive Arbeit leisten müssen.
Zu den reproduktiven Arbeiten gehören alle Arbeiten, welche machen, dass die Lohnarbeiter*innen genügend Energie, genügend gesund und fähig sind, ihre bezahlte Arbeit zu verrichten. Von den klassischen Hausarbeiten, Kochen, Kindererziehung, Einkaufen und Beschaffung von Kleidern bis hin zu der Erwartung, Kinder «herzustellen», zu gebären und die eigene Sexualität hintenanzustellen. Je nach Lebensrealität müssen zudem Lebensmittel produziert werden, um trotz Hungerslöhnen überleben zu können. Diese Arbeiten werden zu grossen Teilen von Frauen erledigt, bleiben unbezahlt und ungewürdigt. Ein Teil dieser unbezahlten Tätigkeiten wird heute als Care-Arbeit bezeichnet. So wird Frauen in freundschaftlichen oder intimen Beziehungen oft die Rolle der unterwürfigen Person zugeschrieben, die auch in emotionalen Fragen und psychischen Problemen helfend zur Seite steht.
Es braucht einen Bruch mit diesem System, das Menschen grundlegend in zwei Kategorien teilt und diese hierarchisiert, sodass die Produktion über der Reproduktion gehoben wird. Wir finden es wichtig, grundlegende Rechte wie rechtliche Gleichstellung der Geschlechter im Kampf gegen das Patriarchat dabei nicht aus den Augen zu verlieren, da diese zu kurzfristigen Besserungen und zu Schutz führen können. Wir sind bereit, Reformen zu unterstützen, die Menschen kurzfristig Hilfe bieten. Als Beispiel sehen wir hier Opferhilfegesetze, welche beispielsweise Zugang zu Frauenhäusern gewährleisten. Reformen zu erzwingen, ist als Teil einer revolutionären Strategie zu werten, weil sich in handfesten Kämpfen Menschen gegenseitig ermächtigen und sich bewusst werden, dass alles verändert werden kann.
Unsere feministische Ausrichtung soll durch die soziale Einfügung in unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen der unterdrückten Klassen wirken und Kämpfe hierarchiearm strukturieren. Wir brauchen breit verankerte Bündnisse, die eine Transformation unserer Gesellschaft möglich machen. Lose Kleingruppen, auch wenn diese vernetzt sind, können jenes Ziel nie erreichen. Nur wenn wir in formellen Strukturen aktiv sind, kann ein reger Austausch möglich werden, können wir an einem Strick ziehen. Gleichzeitig ermöglicht es uns, noch weitere Teilbereiche abzudecken. Unter diesen Teilbereichen verstehen wir die Erschaffung von Kollektiven, welche heute bestehende Probleme lösen oder Abhilfe schaffen. So sollen sich Menschen zusammentun, um Care-Arbeit zu kollektivieren, um kurzfristig in dieser patriarchalen Gesellschaft eine Besserung zu erreichen. Wir erachten es als sinnvoll, dass Schutzräume aufgebaut und respektiert werden. So braucht es Räume beispielsweise für trans und nicht-binäre Menschen, damit diese sich austauschen, organisieren und ermächtigen können.
Es braucht zudem auch Kollektive und Bestrebungen, die sich mit patriarchalen Mustern, Sexismus, machoiden Strukturen und unterdrückenden Mechanismen innerhalb unserer Organisationen auseinandersetzen. Wir wollen Auffang- und Awareness-Strukturen für den Umgang mit Grenzverletzungen, Diskriminierungserfahrungen und sexualisierter Gewalt schaffen. Auch sollen Strategien erarbeitet werden, wie wir mit gewaltausübenden Menschen umgehen und wie deren gewalttätiges Verhalten kritisiert und erreicht werden kann, dass die gewaltausübende Person sich auf einen Veränderungsprozess einlässt und Kritik annimmt und so die individuelle Aufarbeitung von erlebter Gewalt im Sinne einer kollektiven Verantwortung, die wir alle füreinander haben, ermöglicht.
Zu unserem Feminismus gehört der Kampf gegen die sichtbaren patriarchalen Einflüsse in dieser Gesellschaft. Jedoch gehört der Kampf gegen, die Reflexion über und die Betonung von weniger sichtbaren patriarchalen Einflüssen genauso dazu. Beispiele dafür sind: Die Reproduktion von sexistischen Elementen in der Sprache und im Verhalten, die unterschiedlichen Erwartungen, Rededominanz, unfreie Sexualität, der weitverbreitete Konsum sexistischer Pornografie, die das Bild der Sexualität prägt, die Definitionen von Frauen als emotionale Mysterien und von Männern als emotionslose Wesen, etc. Dabei gilt es zu beachten, dass Anarchist*innen nicht «von Haus aus» Feminist*innen sind, dass dies nicht «sowieso» dazu gehört, sondern für jede*n einzelne*n einiges an Arbeit braucht, die anerzogenen sexistischen Denk- und Handlungsmuster zu durchbrechen und neu zu erlernen. Dafür müssen wir uns mit unserem Verhältnis zum gegenseitigen Umgang, antrainierten Rollen, Sprache und unserer Fähigkeit zur gemeinsamen und gleichberechtigten Entscheidungsfindung unseren (sexuellen) Beziehungen beschäftigen.
Der Begriff Anarchafeminismus beschreibt zurzeit vor allem Anarchist*innen, die in irgendeiner Form feministisch (aktiv) sind. Wir wollen dazu beitragen, dies zu ändern – theoretisch wie auch praktisch. Denn wir sind überzeugt, dass anarchafeministische und anarchokommunistische Ideen und das damit zusammenhängende Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung eigentlich weit verbreitet sind, dass diesen Ideen also, wenn sie bekannter würden, von vielen Menschen und insbesondere von Menschen, die Diskriminierung erfahren, zugestimmt würde. Es geht also darum, kollektive Kämpfe zu führen, die das Patriarchat in seiner Funktionsweise und seinen alltäglichen Ausprägungen angreifen. Das halten wir für grundlegend wichtig. Zudem möchten wir auch bei uns selbst als Revolutionär*innen, bei Aktionen oder innerhalb von Organisationen auf patriarchale Muster aufmerksam machen und hierarchische, diskriminierende Handlungen angreifen.
Somit ist unser Feminismus einer für die Menschen der lohnabhängigen Klassen. Ein Feminismus, der verschiedene Unterdrückungsformen gleichzeitig bekämpft und somit immer intersektional sein muss. Unsere Definition eines anarchokommunistischen Feminismus ist längst nicht abgeschlossen. Als weitere Schritte müssen wir die Diskussion darüber eröffnen, Debatten führen und verschiedene Haltungen einander gegenüberstellen, um eine stringente, also widerspruchsfreien, anarchokommunistische und feministische Theorie entwickeln zu können.
Unsere Haltung zur sozialen Revolution
Wir sind der Überzeugung, dass eine herrschaftsfreie Gesellschaft aufgebaut werden kann. Dies wird nicht heute oder morgen sein, aber wir können mit dem Aufbau herrschaftsfreier Strukturen jeden Tag auf dieses Ziel hinarbeiten. Ein Quartierrat zum Beispiel gibt den Bewohner*innen eines Quartiers die Möglichkeit, sich zu äussern. Er zeigt, dass anarchistische Ideen nicht nur theoretisches Geschwafel sind und hilft damit auch die anarchistischen Ideen bekannter zu machen. Die Verbreitung dieser Ideen in den lohnabhängigen Klassen ist unsere wichtigste Aufgabe: Eine Gesellschaft kann nur dann herrschaftsfrei sein, wenn sie bewusst und aus Überzeugung geformt wird.
Auf der anderen Seite dürfen wir uns nicht in die Theorie zurückziehen, sondern müssen uns ernsthaft und glaubwürdig an Kämpfen gegen Ausbeutung und Unterdrückung und für ein würdevolles Leben beteiligen. Immer auf Augenhöhe mit den lohnabhängigen Klassen, von denen wir ein Teil sind. Wir wollen also nicht bloss Arbeit in der «linken Szene» oder für diese leisten, sondern aktiv versuchen, das Bewusstsein der gesamten lohnabhängigen Klassen zu fördern und innerhalb der Gesellschaft aktiv sein. Dafür brauchen wir Inhalte und Strategien, die es uns erlauben in verschiedensten Bereichen zu wirken: Von Arbeitszeiten über Betreuungsarbeit bis zu Lehrplänen an Schulen.
Mit anderen Worten: Wir sehen die Revolution nicht als ein Silberstreif am Horizont und die befreite Gesellschaft nicht als Jenseits. Wir wollen an einem längeren Umwälzungsprozess mit mehreren Etappen arbeiten und sind uns auch bewusst, dass «die Revolution» kein Allheilmittel für alle menschlichen und gesellschaftlichen Leiden und Gebrechen ist: Auch wenn wir den Staat und den Kapitalismus überwunden haben, wird dieser Prozess weiter gehen, bis alle anderen Unterdrückungsformen (wie Rassismus oder Patriarchat) überwunden sind. Erst dann kann eine Gesellschaft frei sein.
Wir glauben im Gegensatz zu autoritären Kommunist*innen nicht daran, dass die Revolution von einer bestimmten Gruppe in der Gesellschaft, wie den Fabrikarbeiter*innen, getragen und vorangetrieben wird. Trotzdem ist der Klassenkampf von unten eine wichtige Grundlage, um den freiheitlichen Kommunismus zu erreichen. Bis dahin bleibt ein unauflösbarer Widerspruch zwischen Herrschenden und Beherrschten bestehen.
Wir würden auf jeden Fall eine friedliche Revolution bevorzugen, aber glauben nicht, dass die herrschenden Klassen ihr Eigentum und ihre Macht freiwillig abgeben werden. Im Gegenteil werden sie mit allen Mitteln die soziale Revolution zu verhindern versuchen. Es ist unsere Aufgabe, in einer solchen Situation der sozialen Revolution den Weg zu ebnen und sie zu verteidigen.
3. Praxis gestalten
Unsere Organisation
Verantwortungsbewusstsein und Selbstdisziplin
Wir wollen nicht wie Soldat*innen strammstehen und Befehle befolgen, sondern als Individuen unsere Aufgaben ernst nehmen und nach bestem Wissen und Können ausführen. Was wir uns vorstellen, ist eine Selbstdisziplin, wie etwa in einem Sportverein. In einem kleinen Fussballclub zum Beispiel gibt es verschiedene Mitglieder, die verschiedene Aufgaben übernehmen: Eine fährt die Spieler*innen an die Spiele, ein anderer bringt Sportgetränke und Wasser, eine steht am Grill und ein anderer kümmert sich um die Pflege des Materials. Sie tun dies nicht wegen einem Lohn, sondern weil ihnen ihr Sport und ihr Verein am Herzen liegt.
Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass natürlich nicht alle Aufgaben immer nur Spass machen und uns voll und ganz erfüllen. Aber auch diese Aufgaben sind notwendig, um unsere Ziele zu erreichen. So wie es notwendig ist, im Konzertlokal die Klos zu putzen, damit wieder ein Konzert stattfinden kann. Wir wollen aber trotzdem nicht eine dem kapitalistischen System nachempfundene Leistungsmaschine aufbauen. Es muss auch möglich sein zu scheitern, um dann wieder neu anzusetzen. Dennoch sehen wir den Wert und die Notwendigkeit, dass wir uns an die gemeinsam getroffenen Abmachungen halten und zugeteilte Aufgaben zuverlässig und zügig erledigen, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn Mitglieder die Umsetzung der Vereinbarungen nicht einhalten können, sollen sie dies frühzeitig zurückmelden, damit eine andere Person einspringen kann. Dies ist keine Schande, denn es gibt unterschiedliche Gründe dafür, warum Unzuverlässigkeiten entstehen. Wenn beispielsweise eine Person wenig Zeit hat und sich dann selbst unter Druck setzt, weil sie eine gewisse Aufgabe übernimmt, die sie dann doch nicht einhalten kann, sollte sie weniger Aufgaben übernehmen und an ihrer Selbsteinschätzung arbeiten. Die Verantwortung für das Gelingen einer Aufgabe liegt aber nicht nur bei einer einzelnen Person, die Organisation kann und soll bei dieser Person nachfragen, wieso etwas nicht gelungen ist und Unterstützung anbieten. Die Organisation hat umgekehrt aber auch eine Verantwortung gegenüber den Einzelnen: Sie sollten nicht überfordert oder übergangen werden und die Organisation soll helfen, eine realistische Selbsteinschätzung zu ermöglichen.
Wahrscheinlich werden nicht alle Menschen dem Ideal der Selbstdisziplin entsprechen (oder nicht jederzeit können). Um uns nicht zu überfordern, sollten wir unsere Ressourcen realistisch einschätzen und uns dementsprechend in die Organisation einbringen. Wer sich aber prinzipiell gegen jede Form von Disziplin stellt, ist wahrscheinlich in einem anderen, unverbindlicheren Zusammenhang besser aufgehoben.
Klare formelle Struktur
In jeder Organisation gibt es wichtige, sich oft wiederholende Aufgaben, wie das Verwalten der Finanzen, einer Webseite oder das Betreuen einer E-Mail-Adresse. Dafür sollen in unserer Organisation klar definierte Aufgabenbereiche und feste Zuständigkeiten geschaffen werden. Denn ohne zuverlässige Erledigung dieser regelmässigen Aufgaben ist jede Organisation quasi handlungsunfähig.
Damit nicht die immer die gleichen Personen diese Aufgaben erledigen, soll möglichst vielen Mitgliedern das Knowhow zu möglichst allen anfallenden Aufgaben vermittelt werden. Zum Beispiel können für die verschiedenen Aufgabengebiete detaillierte Anleitungen erstellt werden, in denen steht was wie zu tun ist.
Wir können alle etwas gut. Und wir können alle voneinander lernen. Wenn wir uns dies bewusst sind und das vorhandene Wissen, die vorhandenen Fähigkeiten gezielt vermitteln, sind wir weniger von einzelnen Personen abhängig und wir können vermeiden, dass einzelne von den Aufgaben überfordert sind oder sich diese gar nicht erst zutrauen.
Wie schon gesagt, ist die ganze Organisation verantwortlich für das Gelingen einer Aufgabe. So kann verhindert werden, dass sich Einzelne überarbeiten oder in einigen Bereichen Spezialist*innen mit einem enormen, kaum vermittelbaren Spezialwissen bilden. Solche Spezialist*innen erledigen ihre Arbeit zwar meistens sehr gut und sehr effizient, reissen aber ein riesiges Loch in die Organisation, wenn sie längere Zeit krank oder auf Reisen sind – oder gar komplett austreten. Diese auf Bildungsweitergabe ausgerichtete Art sich zu organisieren, entspricht am ehesten unserer anarchistischen Grundhaltung von Selbstermächtigung und Selbstorganisation.
Es gibt Aufgaben, welche alle sofort oder mit einer kurzen Anleitung erledigen können und andere, welche etwas mehr Wissen und/oder Fähigkeiten verlangen. So können die meisten einmal in der Woche ein Postfach leeren gehen, an einer Demonstration eine mitreissende und interessante Rede zu halten, ist aber nicht ganz so einfach. Allein schon deswegen, da es eine Aufgabe ist, die sich viele Leute erst mal nicht zutrauen.
Besonders unser Auftreten nach aussen sollte eine gewisse Qualität haben; wir sollten verlässlich und glaubwürdig auftreten. Das heisst nicht, dass keine Fehler passieren dürfen, aber wir sollten uns vor einer öffentlichen Rede die Mühe machen, Genoss*innen zu guten Redner*innen auszubilden. Vorträge können etwa vor eigenem Publikum geübt werden, gute Redner*innen können ihr Wissen weitergeben oder es können Rhetorik- oder Schauspielseminare organisiert werden.
Falls sich nicht alle zu guten Redner*innen ausbilden lassen (wollen), haben wir in diesem Thema ein Fähigkeitsgefälle. Durch diese Gefälle werden wir so etwas wie «Kader» haben. Also Mitglieder, die etwas besser können oder in einem Gebiet mehr wissen. Diesem Punkt wollen wir Rechnung tragen. Anstatt einer oft still geduldeten «Autorität» von Kadern, wollen wir das bewusste Benennen derjenigen Aktiven unter uns, die viel Zeit haben und Fähigkeiten mitbringen, welche für unsere Sache wichtig sind. Um beim Beispiel zu bleiben: Wer gut darin ist, Reden zu halten, Leute mitzureissen und Inhalte charismatisch vermitteln kann, sollte auch genau eine solche Funktion, die seinen Fähigkeiten entspricht, für alle transparent ausführen. Das bedeutet nicht, dass andere sich nicht auch schulen sollten und sich die notwendigen Fähigkeiten und das notwendige Wissen aneignen können. Aber es bedeutet die Fähigkeiten der jeweiligen Aktiven anzuerkennen und sie zu nutzen.
Alle Funktionen in unserer Organisation müssen nach dem Prinzip des imperativen Mandats besetzt werden: Die Funktionen bekommen einen Auftrag und eine mehr oder weniger eng definierte Handlungsgrundlage und werden so weit wie möglich nach dem Konsensprinzip besetzt. Sie können aber jederzeit auf einer Versammlung neu besetzt werden, wenn berechtigte Kritik besteht und eine Zweidrittelmehrheit für die Neubesetzung ist.
Wir streben an, dass wichtige Aufgaben, wie das internationale Sekretariat oder die Kasse, doppelt besetzt werden. Die Herangehensweise, wie Aufgabenbereiche aufgeteilt werden und Fähigkeiten gefördert werden, sehen wir als gemeinsamen Prozess und nicht als Kopfgeburten einzelner. Die so entstandenen Strukturen sind auch nicht in Stein gemeisselt, sondern können bei Bedarf an veränderte Lagen angepasst werden.
Klares Profil
Wir wollen also eine Organisation aufbauen, die sich veränderten Umständen anpassen und darauf reagieren kann. Auf der anderen Seite soll die Struktur dieser Organisation klar, einfach verständlich und belastbar sein, so dass allen Mitgliedern klar ist, was in einer Situation gilt und in welche ungefähre Richtung sich die Organisation bewegen wird. Das heisst, es ist für Interessent*innen möglich, sich vor einem Beitritt mit dieser Struktur und ihren Analysen, Aktionsformen und Werten auseinanderzusetzen und erst dann entscheiden, ob sie beitreten möchten.
Wir möchten also Klarheit schaffen, wie die Organisation aufgebaut ist und welchen Grundsätzen sie folgt. Wir sind der Meinung, dass so immer wiederkehrende Debatten um Grundhaltungen und grundsätzliche Konflikte vermieden werden können. Ein geschärftes Profil dient auch dazu, dass unsere Organisation verlässlich ist: Wir haben uns auf Grundsätze geeinigt und Analysen und Haltungen dazu. Wer mit uns zusammen arbeitet, kann sich diese ansehen, auf diese beziehen und darauf bauen, dass sie für uns gelten.
Unsere Praxis
Der organisierte Anarchismus im deutschsprachigen Raum muss sich weiterentwickeln, wenn er in absehbarer Zeit an gesellschaftlichem Einfluss gewinnen will. Deshalb finden wir es notwendig, eine spezifisch anarchistische Organisation aufzubauen. Unsere Organisation orientiert sich stark an den Theorien des Especifismo. Dieser wurde seit den 1950er Jahren in Lateinamerika ausgearbeitet und beruht auf der Annahme, dass eine politische Organisation eine einheitliche Theorie und Praxis haben muss. Nur mit einer gemeinsamen theoretischen Grundlage aller beteiligten Personen und Zusammenschlüssen, lassen sich inhaltliche Beliebigkeit und Profillosigkeit sowie organisationsinterne Widersprüche vermeiden. Dabei beeinflussen sich Theorie und Praxis gegenseitig. Aus der gemeinsamen theoretischen Grundlage entsteht unsere Praxis und die Erfahrungen aus der Praxis wiederum beeinflussen unsere Theorie. Gemeinsame Ziele entstehen aus gemeinsam geteilten Ansichten, Analysen und praktischen Erfahrungen.
Aus eben diesen Zielen leiten sich gemeinsam getragene, aufeinander abgestimmte Taktiken und Strategien ab. Dabei unterscheiden wir zwischen zwei Strategieebenen: Einerseits die generelle strategische Ebene, also die ideologisch beeinflusste – von unseren ideellen Grundlagen beeinflusste – Strategie. Zum Beispiel, dass wir während einem, über längere Zeit andauernden, revolutionären Prozess die befreite Gesellschaft erkämpfen. Andererseits erstellen wir Kurzzeitstrategien, die durch die Erfahrungen und Reflexion der Praxis entstehen und in Wechselwirkung zur Langzeitstrategie stehen. Wie in den unseren Statuten vermerkt, wird Taktik im Alltag angewendet und die generelle Strategie in grösseren Abständen an Kongressen festgelegt. Taktiken werden mitbestimmt durch Erfahrungen, die wir in den sozialen Einfügungen erlangen. Unter sozialer Einfügung verstehen wir, dass wir uns in sozialen Bewegungen einbringen. Das Ziel der einzelnen Taktiken, ist eine Erneuerung der Verhältnisse. So kann eine Taktik beinhalten, dass wir eine Organisation demokratisieren, indem wir mithelfen, Führer*innen zu entmachten. Diese Entmachtung führt zur Ermächtigung aller anderen Beteiligten in der Bewegung und zum Bruch mit dem Bestehenden und somit näher an eine neue, anarchistischen Prinzipien näheren Ordnung. Dies ist was wir Politik des Bruchs nennen. Die aufeinander abgestimmten Taktiken und Strategien innerhalb der sozialen Einfügungen unserer gesamten anarchistischen Organisation sorgen dafür, dass wir uns nicht in widersprüchlichen, sich gegenseitig ausbremsenden Handlungen verlieren.
Als wichtigstes politisches Handlungsfeld, sehen wir das aktive Mitwirken in sozialen Bewegungen und Basisinitiativen an, die uns selbst auch direkt betreffen Wir stehen Schulter an Schulter mit unterdrückten Menschen, weil auch wir welche sind. Denn wir können uns nur gemeinsam von unseren Unterdrücker*innen befreien. Das bedeutet, dass wir nicht nur in unserer Organisation aktiv sind, sondern uns vor allem in den sozialen Bewegungen einbringen. Dadurch können anarchistische Inhalte in der Gesellschaft geteilt werden. Im Umkehrschluss können wir auch Menschen für unsere Ideenorganisation gewinnen und die praktische Erfahrung in unsere Theorie einfliessen lassen. Wir wollen nicht als fremdes Element in einer Bewegung aktiv sein, sondern dort mitkämpfen, wo es auch unsere Kämpfe sind. Das gleichzeitige Arbeiten in den sozialen Bewegungen und der anarchistischen Organisation, bezeichnen wir als organisatorischer / organisationaler Dualismus.
Keinesfalls wollen wir in den sozialen Bewegungen als eine selbsternannte revolutionäre Speerspitze die Richtung bestimmen, eher wollen wir konstruktiv, als Teil der sozialen Bewegung kämpfen. Das heisst auch, dass wir keine spezifisch anarchistischen sozialen Bewegungen wollen. Wir versuchen in unseren sozialen Einfügungen nicht die ganze Bewegung unter unsere Banner zu ziehen, denn es ist unrealistisch zu glauben, dass alle Menschen in den sozialen Bewegungen Anarchist*innen werden. Lieber wollen wir eine breite und schlagkräftige soziale Bewegung als eine ideologisch komplett geradlinige Bewegung, die aber keine soziale Relevanz besitzt. Wir machen lieber einen Schritt gemeinsam mit hundert Menschen, als dass wir allein hundert Schritte gehen. Wir nennen unser Vorgehen in den sozialen Bewegungen aktive Minorität.
Die sozialen Bewegungen sind auch enorm wichtig, damit wir als Organisation erkennen, ob unsere Analysen und unsere daraus resultierende Theorie auch schlüssig sind und der Realität entsprechen. Somit ermöglichen wir, dass die Praxis unsere Theorie beeinflussen kann. Wir wollen nicht von einer Szeneblase aus universitären Denkzirkeln aus, unsere Theorie formen, sondern durch unsere Erfahrungen in den sozialen Kämpfen. Die Beziehung zwischen unserer Organisation und den Organisationen der sozialen Bewegungen ist auf Augenhöhe. Für uns als Aktive unsrer Organisation bedingen beide Organisationsfelder einander. Ohne Praxis keine der Wirklichkeit entsprechende Theorie, ohne Theorie folgt Profil- und Strategielosigkeit in der Praxis.
Wir sehen den Kampf in sozialen Bewegungen, als Schule um Bewusstsein und Stärke zu gewinnen. Mit sozialen Bewegungen können kleine Erfolge erzielt werden, wie höhere Löhne oder die Abschaffung eines diskriminierenden Gesetzes. Diese Reformen sind Etappensiege, die uns das Bewusstsein, die Kraft und Stärke geben, um für unsere langfristigen Ziele zu kämpfen. Deswegen kann es nicht nur um Reformismus gehen. Reformismus meint, dass das derzeitige System so bleiben kann, wie es aktuell besteht und lediglich etwas nachjustiert werden muss. Für Reformist*innen sind Reformen das einzige Ziel. Unser Ziel ist die soziale Revolution. Denn wir halten daran fest, den Kapitalismus und alle Formen von Ausbeutung, Unterdrückung und Diskriminierung zu beseitigen.
Aus diesem Grund lehnen wir auch zentralistische Organisationsformen ab, da sie Hierarchien, Unterwerfung sowie Fremdbestimmung (re)produzieren. Entscheidungen werden von wenigen getroffen, alle anderen ohne Mitspracherecht, sind davon betroffen. Anstelle von Zentralismus soll unsere Organisation nach den Prinzipien des Föderalismus aufgebaut sein. Also Zusammenschlüsse kleiner, dezentraler Einheiten, welche ihr Handeln auf das Erreichen gemeinsamer Ziele ausrichten. Mit delegierten Personen der kleinen Einheiten (Mitgliedsgruppen), werden Entscheidungen auf übergeordneten Ebenen (Föderationsebene) getroffen. Diese Delegierten, sind mit einem Imperativen Mandat ausgestattet. Das heisst, dass Delegierte an einen von ihnen Vertretenen bestimmten Konsensrahmen gebunden sind, aber eigenmächtige Entscheidungen innerhalb von diesem Rahmen treffen können. So hat jedes Mitglied der Organisation die Möglichkeit sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen.
Die Grundlage einer verlässlichen und verbindlichen Zusammenarbeit, stellt das gemeinsame Handeln und deshalb auch die gemeinsame Verantwortung dar. Dies, da unser Ziel, die befreite Gesellschaft aufzubauen, nur als gemeinsamer Prozess umsetzbar ist. Deshalb handeln wir innerhalb unserer Organisation kollektiv. Alleingänge widersprechen dem. Als Mitglieder der Organisation tragen wir eine gemeinsame Verantwortung für alle unsere Aktivitäten. Dies bedeutet, dass jedes Mitglied alle Tätigkeiten der Organisation versteht und unterstützen kann. Deshalb müssen alle Mitglieder der Organisation Verantwortung für das Gelingen und Umsetzen der Aufgaben übernehmen. Dies nennen wir kollektive Verantwortungsübernahme. Ganz im Sinne, dass nur durch gemeinsam geteilte Verantwortung die kollektive Freiheit erwächst, die eine anarchistische Gesellschaft ausmacht.
Arbeiter*innenbewegung und Gewerkschaften
Es gibt wenige Bewegungen der lohnabhängigen Klassen, die deren Alltag so stark und ausdauernd prägt wie die Arbeiter*innenbewegung. Wieso das so ist, kann einfach erklärt werden: Gewerkschaftsarbeit ist Einmischung. Einmischung in den Alltag – Zusammenschlüsse von Arbeiter*innen setzen sich für konkrete Forderungen ein und sind der Gegenpol zu den Kapitalist*innen. Das Ringen um Arbeitszeiten, um Löhne, Wohnungen und Arbeitsverhältnisse ist der Klassenkampf. Gewinnen wir Arbeiter*innen einen Kampf, erleichtert das unser Leben direkt. Durch diese Kämpfe können wir lernen, dass wir nicht ohne Macht sind – durch den solidarischen Zusammenschluss verstärken wir unsere Durchsetzungskraft und können etwas bewegen. Aber auch in einem langfristigen, auf das Ziel einer klassenlosen Gesellschaft gerichteten Perspektive, können Gewerkschaften eine tragende Rolle einnehmen: Sind sie föderal und demokratisch organisiert, können sie die Keimzelle einer demokratischen, am Wohl aller Menschen orientierten Wirtschaft werden.
Basisgewerkschaften, welche diesen beiden Zielen gerecht werden, sind syndikalistisch. Syndikalismus und Anarchosyndikalismus sind dabei kein Widerspruch zum Anarchokommunismus, sondern eine Ergänzung und vor allem eine Strategie. Der Syndikalismus sieht den gleichzeitigen, parallelen Aufbau von zwei Organisationsformen vor: Einerseits den überregionalen, an Berufen und Herstellungsprozessen orientierten Gewerkschaften, und andererseits die alle Menschen einer Region vereinigenden, an Verteilung der Güter und Dienstleistungen orientierten Arbeitsbörsen. Durch diese und die mit ihnen geführten Kämpfe sammeln wir die nötigen Erfahrungen, wie eine andere Gesellschaft zu organisieren ist. Anarchosyndikalistische Gewerkschaften haben durch die Orientierung am Konkreten, ein enormes revolutionäres Potential. Weil sie auf eine möglichst grosse Mitgliederzahl abzielen, können sie aber keine reinen Ideenorganisationen sein. Deshalb befürwortet Midada den Aufbau einer eigenständigen, aber solidarischen anarchokommunistischen Organisation.
Viel öfter sind Gewerkschaften aber nicht syndikalistisch, sondern eher geprägt von sozialdemokratischen oder marxistischen Ideen. Diese Gewerkschaften zeichnen sich fast immer durch eine starre, hierarchische und bürokratische Struktur aus. Im Gegensatz zu den syndikalistischen und an der Basis orientierten Gewerkschaften wird die Gewerkschaftsarbeit von bezahlten Funktionär*innen erledigt. Da die Existenzgrundlagen andere sind, hat der bezahlte Apparat oft andere Interessen als die Mitglieder. In diesen Organisationen können wir uns nur unter extrem erschwerten Bedingungen einbringen, da gegen diese verknöcherten Strukturen aus mangelnder Demokratie und undurchsichtigen Beziehungsnetzen vorgegangen werden muss.
Zustand der anarchistischen Bewegung
Im Moment gibt es im deutschsprachigen Raum keine radikalen Massenkämpfe oder Revolten, die an den herrschenden Verhältnissen rütteln könnten. Die Proteste sind in der grossen Mehrheit zahm (Deutschland, Österreich) oder auch bis vor kurzem fast gar nicht vorhanden (Schweiz), Ausnahmen sind höchstens die meistens sehr kleinen und damit oft begrenzt wirkungsmächtigen Proteste der wenigen Linksradikalen
Von 2008 bis ungefähr 2011 gab es eine für die Schweiz im Allgemeinen untypische Häufung von offen ausgetragenen Arbeitskämpfen. Dies begann mit dem Besetzungsstreik in den Werkstätten von SBB Cargo in Bellinzona (auch bekannt als Officine Bellinzona) im März 2008. Dieser siegreiche und radikal geführte Streik mag eine Inspiration für einige Arbeitskämpfe gewesen sein, doch entscheidender war wohl die Weltwirtschaftskrise ab 2007, denn fast alle Auseinandersetzungen waren Abwehrkämpfe. Sie hatten als Ursache einen Angriff des Kapitals, also Werksschliessungen und Entlassungen. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist der Besetzungsstreik der Verkäufer*innen bei Spar Baden-Dättwil. Dieser Streik wurde vor allem von migrantischen Frauen getragen und nach aussen präsentiert und entzündete sich an tiefen Löhnen und hoher Arbeitsbelastung. Daneben gab es in dieser Zeit auch einige lange Streiks, die nur von einer Minderheit der Belegschaft getragen wurden, etwa im Neuenburger Spital La Providence.
Diese höhere Kampfbereitschaft in den Betrieben übertrug sich aber nur sehr vereinzelt auf andere Bereiche, in denselben Zeitraum fällt etwa der Protest der Student*innen gegen die Bologna-Reform, die nach österreichischem Vorbild zu Besetzungen an verschiedenen Schweizer Universitäten führte, die sich aber meistens nicht länger als ein bis zwei Wochen halten konnten – auch weil die grosse Mehrheit der Student*innen den Streik gar nicht oder nicht aktiv unterstützte. Sonstige Themen, die noch um die Jahrtausendwende viele Menschen mobilisieren konnten, wie die Antikriegs- oder die Antiglobalisierungsbewegung befanden sich schon im Niedergang. Sehen wir von den Berner Freiraumprotesten unter dem Motto «Tanz dich frei» ab, dessen Mobilisierung in Tränengas und Anti-Terror-Rhetorik ertränkt wurde, war erst die Klimabewegung und die feministische Bewegung wieder in der Lage, Menschen ausserhalb der radikalen Linken zu begeistern und auf die Strasse bringen. Gleichzeitig rumort es in der Arbeitswelt wieder etwas mehr. So führten Konflikte gegen die Zentralgewerkschaften in der Nord- und Westschweiz zur Gründung von neuen Gewerkschaften, die in eine syndikalistische Richtung neigen.
Ausserhalb der wieder etwas verblühten Bleiberechts- und Klimabewegung sind kaum Ansätze einer langfristigen Organisierung zu spüren, die stärkeren und effektiveren Protest ermöglichen könnte – am meisten noch in den feministischen Organisationen, die um den Frauenstreik 2019 herum entstanden und bei den oben erwähnten Basisgewerkschaften. Auch die anarchistische Bewegung ist zu schwach oder nicht in der Lage, dazu beizutragen oder die Proteste zu radikalisieren und liess in den Corona-Jahren zu grossen Teilen eine gute Gelegenheit ziehen, als sie sich orientierungslos ins Private zurückzog, weil der courant normal nicht mehr möglich war. Unser Ziel sollte deswegen sein, die Sackgasse der Subkultur zu verlassen und uns an Bewegungen beteiligen, damit sich unsere Ideen verbreiten können und wir neue Mitstreiter*innen gewinnen können.
Die anarchistischen Gruppen schaffen es nur selten ihre Aktivist*innen über das Alter von 25 hinaus zu halten. Das führt dazu, dass der Bewegung stets Wissen und Erfahrungen verloren gehen. Viele hören auf, weil sie entmutigt sind, innerhalb der Gruppen Diskriminierung, Ausschluss, Übergriffe oder Mobbing erfahren. Andere, weil sie durch Repression traumatisiert werden und über das Erlebte aufgrund fehlender Gefässe oder einer auf Leistung und Heldentum ausgelegten Kultur nicht sprechen und darum nicht verarbeiten können.
Darüber hinaus gibt es unzählige weitere Missstände wie sexualisierte Gewalt, Abwertung von nicht cis männlichen Rollenbildern und Akzeptanz von Gewaltbereitschaft gegen Menschen. Die anarchistische Szene im breiteren Sinne ist aber zu heterogen, um stimmige Aussagen über die ganze Bewegung zu treffen.
Was sind denn die Gründe sind für die Schwäche des Anarchismus auf dem Gebiet der Schweiz, im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus?
Strategielosigkeit
Im deutschsprachigen Raum gibt es nur wenige Gruppen, die eine durchdachte und schlüssige Strategie entwickelt haben und verfolgen, auch wenn dies zumindest in Deutschland zum Anspruch vieler Organisationen gehört. In der Schweiz bewegt sich der anarchistische Aktivismus in der grössten Mehrheit nicht mal entlang von Lust und Laune, sondern scheinbar rein zufällig entlang von «Modethemen». Dies sind Themen die plötzlich äusserst beliebt werden und nach einer Zeit vom nächsten plötzlich beliebten Thema abgelöst werden. Die Folge davon ist eine gewisse Beliebigkeit in Aktionsformen und Auftreten, was etwa dadurch sichtbar wird, dass eine Demo gegen Polizeigewalt in der eigenen Stadt und eine andere Demo in Solidarität mit einer Bewegung in einer anderen Weltgegend fast gleich aussehen und klingen.
Eine weitere Folge ist, dass Themen wild zusammen kombiniert werden, ohne dass gefragt wird, ob und wie sie zusammenpassen und ob es Widersprüche gibt oder geben darf. Kritik daran, wird dann meistens als Grundsatzkritik verstanden und energisch beiseite gewischt. Möglich ist dies nur, weil sich kaum jemand tiefergehende theoretische und analytische Gedanken macht – die Praxis steht absolut im Vordergrund. Diese Strategielosigkeit stammt zu einem guten Teil auch aus einer diffusen Auffassung von Anarchismus: Ohne klares und schlüssiges Grundkonzept, ist es schwierig eine Strategie zu entwickeln. Durch die Strategielosigkeit ist die Gefahr eines erneuten Einbruchs der organisierten anarchistischen Bewegung immer wieder gegeben (wie in den letzten Jahrzehnten wieder und wieder zu beobachten war).
Beliebigkeit und Profillosigkeit
Um die anarchistischen Ideen zu verbreiten, müssen wir uns klar sein, was diese genau sind. Erst wenn wir ein klares Konzept und Profil haben, können wir dies anderen schmackhaft machen. Erst dann können wir uns einig sein, was unser Projekt und was unser Ziel ist: Auf dem Weg zur sozialen Revolution, brauchen wir eine gesellschaftliche Bedeutung und die erreichen wir nur mit einer klaren Strategie, mit klaren Zielen und einem klaren anarchistischen Grundsatzkonzept. Ohne diese ist es unmöglich zu sagen, ob das, was wir gerade tun, das Richtige ist und ob es uns unseren Zielen näherbringt. Wir haben deswegen den Anspruch, dass wir unsere Positionen und Haltungen jederzeit begründen können – und dass wir es uns auch erlauben, falsch zu liegen, um dann unsere Positionen der Realität anzupassen. Ist hingegen unklar, was das Ziel ist und wie dieses erreicht werden kann, ist alles beliebig und dann ist auch alles, was wir tun, irgendwie richtig – nach dem Motto: «Alles, was wir tun, ist besser als nichts zu tun und jede*r, der etwas tut, bewegt was». Das stimmt leider nicht. Wir können noch so viel tun und noch so sehr der Meinung sein – wir sind die Guten – dies allein wird nicht reichen. Im Gegenteil: Dieses System und seine Repressionsapparate arbeiten hocheffizient, strategisch und zielorientiert gegen uns. Wir können den Herrschenden keinen grösseren Gefallen tun, als Beliebigkeit und Strategielosigkeit dagegenzuhalten.
Desorganisation
Mit dem Erstarken der anarchosyndikalistischen Basisgewerkschaft «Freie Arbeiter*innen Union» (FAU) in Deutschland und der Schweiz sowie der vermehrten Gründung und längeren Aktivitätsdauer anarchistischer Gruppen und Publikationen in Deutschland ist ein neuer Aufschwung des organisierten Anarchismus zu beobachten. Auch in der Schweiz stellen sich unabhängig voneinander Gruppen von Anarchist*innen in verschiedenen Städten die Frage, wie der Beliebigkeit des bisherigen Aktivismus entronnen werden kann.
Dennoch darf uns dies nicht die Sicht vernebeln: Die deutschsprachige anarchistische Bewegung ist in der grossen Mehrheit immer noch für Aussenstehende unzugänglich. Einerseits, weil ein grosser Teil der Anarchist*innen sich nicht dauerhaft und kontinuierlich organisiert und andererseits, weil eine grosse Skepsis gegenüber neuen Menschen da ist. Dies ist für eine Subkultur normal, aber einer politischen Bewegung unwürdig und für diese sogar schädlich. Anarchistische Gruppen bleiben oft klein, es trifft sie deswegen oft schwer, wenn Mitglieder mit ihrem Engagement aufhören. Dies macht es auch schwierig längerfristige und ambitioniertere Projekte zu verwirklichen.
Unzuverlässigkeit
Ein weiteres Problem ist die, unserer Erfahrung nach, stark verbreitete Unzuverlässigkeit in den anarchistischen Gruppen. Nach jedem Treffen, nach jedem Kongress, nach jedem Plenum, in dem stundenlang die wildesten Pläne abgestimmt werden, wird am Ende nur ein Bruchteil des Besprochenen umgesetzt – und das auch noch überwiegend von den «üblichen Verdächtigen». Auch das konkrete Benennen von Verantwortlichen hilft nichts, wenn die Umsetzung nicht erfolgt und für die dafür Verantwortlichen keinerlei Konsequenzen entstehen.
Das anarchistische Grundprinzip der freien Vereinbarung bedeutet, freiwillig und selbstverwaltet Aufgaben zu übernehmen und diese verbindlich umzusetzen. Natürlich können bei der Umsetzung von Aufgaben Schwierigkeiten entstehen, die nicht vorhersehbar waren. Falls es jemandem nicht möglich ist, die übernommene Aufgabe zu erfüllen, können andere Genoss*innen helfen. Für uns ist Verantwortungsbewusstsein die unmittelbare Konsequenz des anarchistischen Prinzips der freien Vereinbarung. Wir fordern keinen blinden Gehorsam, sondern die Ernsthaftigkeit der Genoss*innen, sich in ihren eigenen freien Entscheidungen ernst zu nehmen. Wir sind uns im Klaren, dass es keine perfekten Revolutionär*innen gibt. Wir sind alle von diesem System geprägt und bringen von daher unsere Fehler und Probleme in die Organisation mit. Es ist für uns trotzdem fundamental, anarchistische Werte bereits hier und jetzt in unsere Leben so gut es geht einzubauen und nach ihnen zu leben.
Um die soziale Revolution voranzutreiben, brauchen wir Organisation. Wir brauchen keine Partei, die Menschen zu einer Phrasen nachblökenden Schafherde herabstuft. Wir brauchen vielmehr eigenständige, selbst denkende und revolutionäre Menschen, die auf Basis der anarchistischen Grundprinzipien ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten vereinigen. Nur so können wir vorangehen.
Falsch verstandene Autonomie
Die Punkte oben sind leider nicht die einzigen Mankos der jetzigen anarchistischen Bewegung, Bremsen gegen ein effizientes Voranschreiten sind ausserdem:
- Ein falsch verstandener Freiheitsbegriff, der die Rechte und Freiheiten jeder einzelnen Person als höchstes Gut ansieht. Deswegen werden freiwillige Vereinbarungen als Zwang missverstanden und abgelehnt. So sind klare Absprachen, die zuverlässige Erledigung von Aufgaben und das gegenseitige Bauen auf Solidarität nicht möglich.
- Spontanität ist in bestimmten Situationen eine Stärke und ermöglicht es sich auf (unerwartete) Ereignisse und Veränderungen schnell anzupassen und passender zu (re)agieren. Wenn der Spontanität aber eine zu hohe Bedeutung gegeben wird, führt es dazu, sich nicht festlegen zu wollen und sich alle Möglichkeiten offen zu halten. Dieses in der anarchistischen Bewegung verbreitete «sich-nicht-festlegen-wollen», kann bei langfristigen und komplexen Projekten zur Handlungsunfähigkeit führen. Wir glauben, dass langfristige Arbeit ohne Vorbereitung nicht oder nur sehr beschränkt möglich ist und auch die spontane Reaktion solide Grundlagen wie gemeinsame Analysen benötigt. Unstrukturiertes Vorgehen hat ausserdem einen unschönen Nebeneffekt: Da die Ressourcen der Einzelnen nicht vorausgeplant werden können, bilden sich schnell eingeschliffene Strukturen zum Vorteil derer, die sich mehr Zeit für ein Projekt nehmen können.
- Da die anarchistische Bewegung heute zu grossen Teilen eine Subkultur ist, funktionieren viele grundlegende Strukturen nur über Spass. Das beste Beispiel dafür ist die Geldbeschaffung: Spendenaufrufe verhallen ungehört, Solipartys hingegen begeistern die Leute. Auch wenn revolutionärer Kampf nicht mit linkem Hedonismus verwechselt werden darf, wollen wir eine Gegenkultur aufbauen, die die Grenzen der Subkultur sprengt. Und wir sind überzeugt, dass Spass nicht der Hauptgrund für unsere Praxis sein darf, aber wir auch Spass in unserem Leben haben müssen, um psychisch gesund und der Bewegung erhalten zu bleiben.
- Anarchismus als Subkultur führt dazu, dass die anarchistische Bewegung um sich selbst, die eigene Szene oder die eigenen Räume kreist. Anstatt in und mit der Gesellschaft zu arbeiten, wird in erster Linie die eigene Szene bedient. Subkulturen haben positive Effekte, wie Geborgenheit und Identität oder die Möglichkeit bürgerlich-restriktive Werte ablegen zu lernen. Doch dies wiegt den Nachteil nicht auf: Eine Subkultur steht in Abgrenzung zur restlichen Gesellschaft. Plakativ gesagt: Statt in die Gesellschaft hineinzuwirken wird gegen die Gesellschaft gekämpft.
Als Teil der Gesellschaft in Richtung Revolution
Die soziale Revolution und der Aufbau einer freien Gesellschaft ist nur zusammen mit einem Grossteil der Menschen eines Gebiets umsetzbar, sonst wird es eine autoritäre Umwälzung und scheitern. Diese Einsicht wird in der anarchistischen Bewegung immer noch zu wenig gelebt. Wir verstehen, dass es einfacher ist, in einem Umfeld von grob ähnlich denkenden Menschen aktiv zu sein. Dass es angenehmer ist, wenn nicht in jeder Diskussion bei null angefangen werden muss und weniger kritische Fragen gestellt werden. Doch deswegen sind «die Anderen» nicht Feindesland, deswegen sind sie nicht begriffsstutzig oder dumm. Viele Menschen können bloss unseren Ideen und Argumenten nicht folgen, weil sie die Sprache der Subkultur nicht verstehen oder gar hören können. Anstatt auch mal im Quartier oder im Dorf, auf der Arbeit oder in Nicht-Szeneorten präsent zu sein, werden nur die eigenen vier Wände des lokalen autonomen Zentrums genutzt. Eine zu grossen Teilen einheitliche Subkultur führt auch dazu, dass Menschen, die einen anderen Musik- oder Kleidergeschmack oder andere Hobbys haben, nicht zum Anarchismus finden oder wenn sie es trotzdem tun, von der Subkultur nicht ernst genommen werden. Wir wollen aber kein heimeliges Auffangbecken aufbauen, sondern eine schlagkräftige politische Bewegung.
Wenn wir uns in der Echokammer der Subkultur bewegen, isolieren wir uns selbst und verlieren den Bezug zur Lebensrealität der Menschen. Wir entfremden uns von der Gesellschaft, in der Folge drehen sich viele Diskussionen nur noch um uns selbst. Dies ist manchmal notwendig, um selbstkritisch unsere Standpunkte und Entwicklungen als Bewegung zu überprüfen. Nur: Wie sollen wir eine freie Gesellschaft erreichen, wenn wir nicht innerhalb der Gesellschaft aktiv sind und uns als Teil von ihr sehen, sondern aus unserem vermeintlich sicheren, widerspruchsfreien und erleuchteten Szene-Elfenbeinturm auf sie herabblicken?
Gleichzeitig ist in der anarchistischen Bewegung die Einstellung weit verbreitet, dass es wenig Hoffnung auf einen revolutionären Wandel gibt. Dies darf nicht unterschätzt werden. Auch wenn wir einen kritischen und ernsthaften Blick auf die momentanen Zustände haben müssen, richtet diese fehlende Hoffnung enormen Schaden an: Die eigenen Aktivitäten werden unbewusst als weniger wirksam und sinnvoll bewertet oder sogar ins Lächerliche gezogen. Und damit steigt die Gefahr, dass sich Aktivist*innen zurückziehen, weil die politische Arbeit sinnlos erscheint. Und wie sollen wir andere Menschen dazu überzeugen können, sich den anarchistischen Ideen anzuschliessen, wenn wir von deren Verwirklichung nicht überzeugt sind?
Das Fehlen einer offenen, solidarischen Kritik untereinander
Einerseits haben anarchistische Zusammenhänge durch ihre Atmosphäre und vertraute Nähe eine nicht zu unterschätzende Ausstrahlung. Andererseits ist es leider so, dass deutliche Schwächen vorhanden sind, wenn es darum geht, sich gegenseitig zu kritisieren. Dies betrifft sowohl inhaltliche Auseinandersetzungen als auch persönliche Kritik an Verhalten, Aufgabenerledigung oder zwischenmenschlichen Konflikten – auch und gerade, wenn diese Kritik schmerzlich sein kann. Es gibt häufig Probleme innerhalb von Gruppen, die nicht offen kommuniziert werden. Dies kann Differenzen zwischen verschiedenen Menschen betreffen; fehlende Kritik bei unzuverlässigem Verhalten verstärkt aber unzuverlässiges Verhalten. Meistens wird eine oberflächliche, harmonisch-sichere Atmosphäre vorgezogen, anstatt offen, ehrlich und solidarisch über Widersprüche und Probleme zu diskutieren und sie zu lösen. Die Konflikte lösen sich aber nicht einfach magisch auf, sondern können zu Mobbing, Übergehen von Minderheitsmeinungen und informellen Hierarchien führen. Explodiert dann der Konflikt, wird es schwierig noch eine gemeinsame Grundlage zu finden.
Diese mangelnde Kritikkultur schadet auch einer inhaltlichen Auseinandersetzung, also der Weiterentwicklung und Anpassung unserer Analysen und Strategien. Viel zu oft werden lieber die Phrasen von vorgestern wiederholt, als sich ernsthaft mit den eigenen Inhalten zu beschäftigen. Wir denken aber, dass eine Strategie nur erfolgreich sein kann, wenn sie ständig mit der Realität abgeglichen und dann angepasst wird. Wir möchten als Teil der Gesellschaft eine Verbesserung der Situation der Lohnabhängigen erreichen – und nicht bloss eine Wohlfühloase für vage Gleichdenkende und -handelnde.
Öffentliche Unsichtbarkeit und schlechte Aussenwirkung
Der Anarchismus hatte schon immer Mühe, ausserhalb der eigenen Bewegung ein gutes Bild von sich zu vermitteln. Zudem behaupten manche anarchistische Kreise immer wieder, dass Aktionen für sich selbst sprechen würden. Deshalb machen sich diese Kreise gar nicht mehr die Mühe, ihre Aktionen bekannt zu machen. Die Aufarbeitung und das Sichtbarmachen unserer Aktivitäten in der Gesellschaft, also ausserhalb der subkulturellen Grenzen, kommt regelmässig zu kurz.
Wo sind die anarchistischen Influencer*innen? Wo sind die anarchistischen Videoportale? Wo sind die medial aufsehenerregenden Aktionen? Wo sind die Leute, die ihr Gesicht als organisierte Anarchist*innen in eine Kamera halten? Die öffentlichkeitswirksamen Werkzeuge der anarchistischen Bewegung sind in die Jahre gekommen. Neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit werden zu wenig und ohne strategische Überlegungen einbezogen. Dort wo sie bedient werden, bleiben sie viel zu oft in der «anarchistischen Blase» stecken.
Uns ist bewusst, dass es gute Gründe gibt, nicht alles für die Öffentlichkeit zu dokumentieren und auch an Schutz vor Repressionsorganen oder Rechtsextremen zu denken. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, welche Sicherheit wir wann brauchen, wie dies erreicht werden kann und ob es sich in Bezug auf unsere Ziele lohnt. Denn der Nachteil dieser Sicherheit ist fast immer, dass wir von der Öffentlichkeit nicht mehr wahrnehmbar sind oder, noch schlimmer, missverstanden werden. Denn Sympathien können nur aufgebaut werden, wenn wir verstanden und gesehen werden.
Unser Verhältnis zu anderen anarchistischen Strömungen und Organisationen
Wir wollen eine anarchokommunistische Ideenorganisation mit einer einheitlichen Basis und Ausrichtung aufbauen. Trotzdem sind wir nicht der Meinung, dass sich alle Anarchist*innen unter einem Dach vereinen sollen oder müssen. Zur richtigen Zeit, also auf Basis einer stimmigen und realistischen Analyse, können uns auch verschiedene Ansätze vorwärtsbringen. Dabei sollen im Hier und Jetzt schon Verbesserungen für unsere Lage erkämpft werden, denn diese Kämpfe dienen als «Schule der Revolution»: Wir können durch diese Kämpfe lernen, uns zu wehren und unserer Stärke als solidarisch zusammenstehende Lohnabhängige bewusst werden. Diese Verbesserungen sollen uns aber nicht vom Ziel einer befreiten Gesellschaft ablenken. Wir denken aber, dass es unser Projekt und unsere Mitstreiter*innen nicht weiterbringt, wenn wir in frommer Demut alle Missstände hinnehmen, weil im «Jenseits», also nach einer Revolution, alles besser werde.
Mit anderen Worten fordern wir zwar ein ernsthaftes und gewissenhaftes Engagement, verlangen aber nicht, dass wir jede Handlung in unserem Leben am Wert für die Revolution messen müssen. Wir müssen auch ein Leben haben können, dass uns die Kraft und Energie gibt, weiterzumachen. Sonst drohen wir in Burn-Outs zu versinken und uns zu entmenschlichen. Deswegen, um unsere Theorien in der Praxis zu testen und um weitere Leute für unsere Ideen zu gewinnen, sind gelebte Strukturen wie Kommunen, Kollektivbetriebe und solidar-ökonomische Netzwerke, Tausch- und Gratisläden und Basisgewerkschaften wichtig. Trotzdem haben diese Strukturen teils auch die Konsequenz, dass sie wieder eine isolierende Wirkung auf die dort arbeitenden, meist politisch aktiven Menschen haben und so eher einen Rückzug ins Gemütliche, statt den Kampf und weitere Organisation nach sich ziehen. Zudem werden wir mit Kollektivbetrieben auch nicht das herrschende System überwinden und viel zu oft arbeiten dort Menschen zu schlechteren Bedingungen als in einem gewöhnlichen Betrieb.
Eine spezifisch anarchistische Organisation, die stark von den Theorien des Especifismo beeinflusst ist, gibt es im deutschsprachigen Raum nicht, auch wenn die plattform und Perspektive Selbstverwaltung ähnliche Ansätze verfolgen. Wir verstehen uns als Erweiterung des anarchistischen Kampfes. Wir denken aber, dass es aktuell nichts Wichtigeres gibt, als die dauerhafte, formelle Organisation mit Gleichgesinnten im Kampf für eine befreite Gesellschaft. Deshalb werden wir die (solidarische) Kritik und Diskussion über individualistische Tendenzen in der Bewegung entfachen.
Dazu kann auch gehören, dass wir uns je nach Situation klar gegen einzelne Ausprägungen des Anarchismus stellen müssen, um uns von gewissen Irrwegen abzugrenzen. Dies können zum Beispiel individuelle (Terror-)Handlungen und undurchdachte Alleingänge sein. Denn diese können, wenn sie bloss in der Echokammer einer geschlossenen Szene bewertet und kritisiert werden, realen Kämpfen und Bewegungen mehr schaden als nützen. Das lässt sich in der Geschichte des Anarchismus etwa anhand der Illegalist*innen oder den Verfechter*innen der Tyrannenmorde (unter dem Stichwort der Propaganda der Tat) deutlich sehen – oder auch ausserhalb des Anarchismus bei den Kampagnen gewisser marxistischer Stadtguerillas, wie der Roten Armee Fraktion in Deutschland oder der Brigate Rosse in Italien.