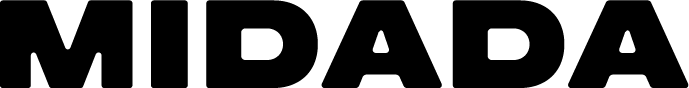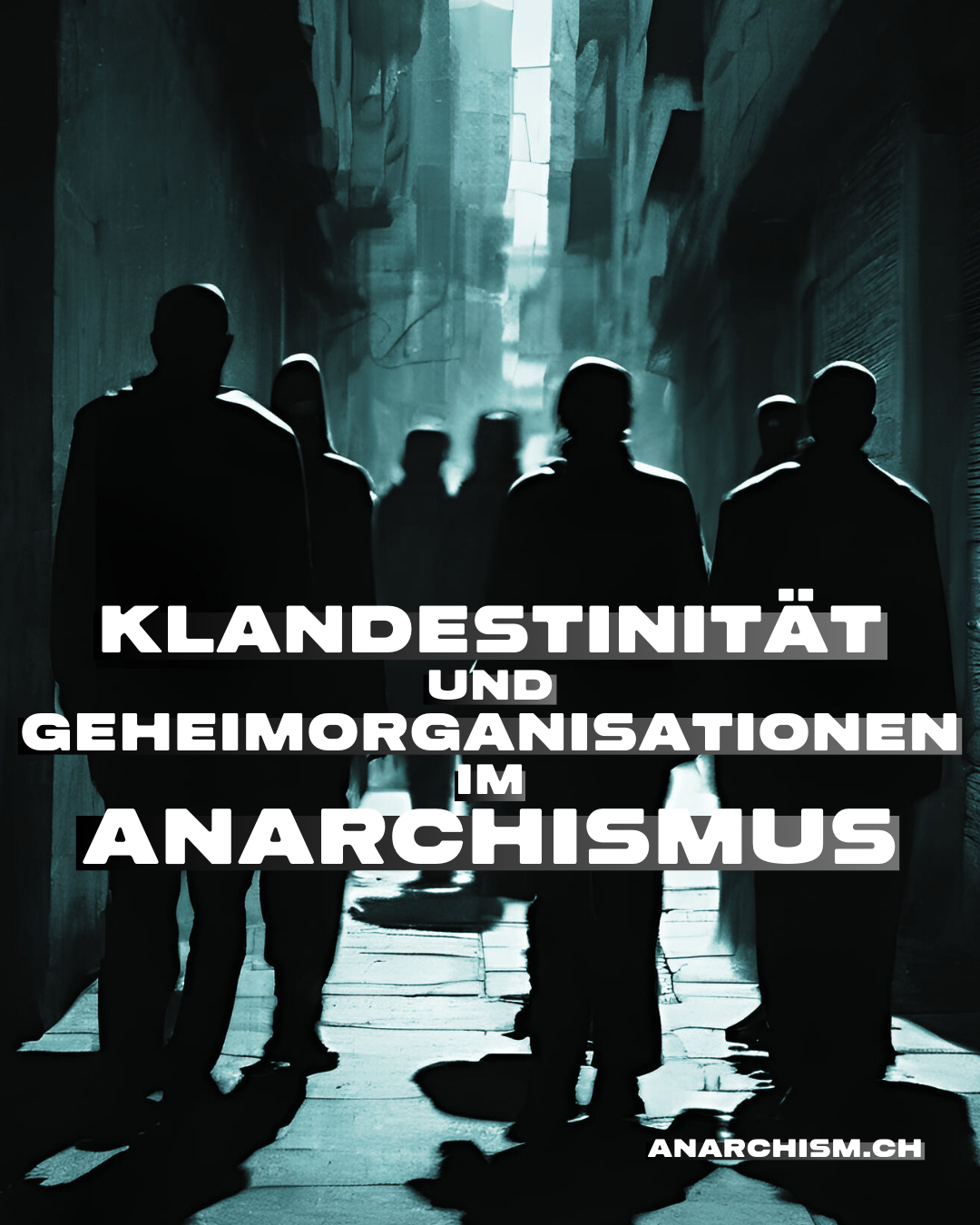Wie sollen sich Anarchist*innen organisieren und vor allem auftreten, wenn sie ernsthaft versuchen, die Gesellschaft zu verändern? Diese Frage ist aktueller denn je, auch wenn sie schon uralt ist. Rudolf Rocker äusserte sich im Text „Anarchismus und Organisation“ vor mehr als hundert Jahren sehr deutlich dazu. Es ist erstaunlich, wie aktuell der Inhalt dieses Textes noch immer erscheint. Aus diesem Grund haben wir die Grundinhalte dieses wichtigen Textes zusammengefasst. Beginnen möchten wir mit demselben Satz, mit dem auch Rocker vor über hundert Jahren begann:
„Es ist durchaus kein erfreuliches Zeichen, dass man sich in anarchistischen Kreisen über diese Frage noch immer nicht klar zu sein scheint, obwohl sie für die anarchistische Bewegung als solche und ihre weitere Entwicklung von schwerwiegender Bedeutung ist.“
Verwirrung durch Selbstisolation
Rocker war der Ansicht, dass geheime Organisationen zwar beeindruckende Opferbereitschaft und Hingabe fördern können, doch ohne den Kontakt zu den Massen fehlt ihnen die Grundlage für langfristige Wirksamkeit. Ihre Mitglieder verlieren oft den Bezug zur Realität, entwickeln eine rein negative Denkweise und entfremden sich von den eigentlichen Bedürfnissen der Gesellschaft. Unter repressiven Bedingungen können solche Organisationen zwar das Überleben sichern, doch sie sind nicht in der Lage, umfassende gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Sozialer Wandel setzt voraus, dass breite Teile der Gesellschaft durch intensive Aufklärung von neuen Ideen überzeugt werden. Die romantische Faszination geheimer Strukturen, besonders auf junge Menschen, führt jedoch oft zu einer verzerrten Wahrnehmung der Wirklichkeit. Statt die Welt realistisch zu sehen, verfallen viele einem Wunschdenken und verlieren den Blick für die wahre Dimension der Herausforderungen.
Selbstlähmung durch Paranoia
Weiter führt Rocker aus, dass diese geheimen Organisationen zwangsläufig grosse Risiken mit sich bringen, vor allem bezüglich dem ständigen Kampf gegen die Überwachung des Staates. Dieser Konflikt kostet nicht nur immense Energie, sondern fördert bei den Beteiligten oft ein krankhaftes Misstrauen, das sie nachhaltig prägt. Das Misstrauen durchzieht jede Ebene der Organisation, belastet zwischenmenschliche Beziehungen und zerstört häufig das Vertrauen innerhalb der Bewegung. Persönliche Konflikte nehmen oft einen verhängnisvollen Charakter an, da der enge Rahmen dieser Organisationsweise und die begrenzten Ressourcen Spannungen zusätzlich verschärfen. Ein allgegenwärtiger Generalverdacht und Vorsichtsmassnahmen lenken die Aufmerksamkeit und Energie der Mitglieder immer weiter vom eigentlichen Ziel ab. Insgesamt tragen diese Faktoren dazu bei, dass die Bewegung in ihrer Stärke und Handlungsfähigkeit erheblich geschwächt wird.
Von der Notwendigkeit zum Dogma I
Geheimorganisationen beeinflussen stark die geistige Struktur ihrer Mitglieder, so Rocker. Sie hemmen die kreative Entwicklung der Bewegung, da sie gezwungen sind, destruktive Aktivitäten in den Vordergrund zu stellen. Diese Phase der Geheimhaltung prägte die anarchistische Bewegung der 1870er Jahre stark. Viele Mitglieder, insbesondere neue, begannen, konspirative Tätigkeiten als normalen Zustand der Bewegung zu akzeptieren und diese der öffentlichen Arbeit vorzuziehen. Diese Sichtweise wurde zur dominanten Haltung, wie das „Italienische Komitee für die soziale Revolution“ in einem Manifest an den Kongress der Internationale 1874 deutlich machte. Darin verwarf das Komitee jede Form öffentlicher Aktivitäten als schädlich und stellte die Geheimorganisation als Grundvoraussetzung der Bewegung dar. Diese Haltung zeigt, wie stark die Atmosphäre von Geheimhaltung und Konspiration die anarchistische Bewegung jener Zeit geprägt hatte.
Von der Notwendigkeit zum Dogma II
In der anarchistischen Bewegung der 1870er Jahre stand die Organisation stark im Zeichen von Verschwörungen und terroristischen Aktionen. Ausugst Reinsdorf und viele andere deutsche Anarchist*innen verstanden den Anarchismus vorwiegend als eine geheime, auf Gewalt basierende Bewegung und verwechselten diese vorübergehende Form mit den grundlegenden Zielen des Anarchismus. Besonders Reinsdorf zeigte in seinen Schriften, wie er sich von autoritären Ideen beeinflussen liess, ohne sich dessen bewusst zu werden, etwa als er den „Revolutionären Katechismus“ fälschlicherweise Bakunin zuschrieb. In dieser Zeit, in der revolutionäre Bewegungen gezwungen waren, im Verborgenen zu agieren, verbreiteten sich Missverständnisse und Verirrungen. Die Atmosphäre der äussersten Geheimhaltung führte dazu, dass viele Mitglieder der Bewegung von den eigentlichen anarchistischen Prinzipien abwichen. Insgesamt zeigte sich, wie solche Phasen der Geheimhaltung die Bewegung in eine falsche Richtung lenkten.
Fazit
Wir sind der Meinung, dass die aufgeführten Punkte auch heute noch sehr zutreffend sind. Wir gehen sogar noch weiter und sind überzeugt, dass das offene Auftreten von Anarchist*innen, besonders in Zeiten wie jetzt, einen gewissen Schutz bieten kann. Die Mitglieder von Midada treten seit Jahren stets offen auf und verwenden ihre echten Namen. Natürlich erkennen wir an, dass es Zeiten gibt, in denen Geheimorganisationen unumgänglich sind. Dennoch sind wir überzeugt, dass in der heutigen Zeit und an den Orten, an denen wir aktiv sind, ein offenes Auftreten viel gewinnbringender ist – besonders, wenn unser Ziel der Aufbau von Volksmacht ist. Dieser Beitrag soll euch ermutigen, darüber nachzudenken und Dogmen zu hinterfragen, die sich eingeschlichen haben, ohne einen echten Nutzen zu bieten. Wenn wir die anarchistischen Ideen ernst nehmen und den Willen haben, gesellschaftlichen Wandel zu erzeugen, müssen wir aus der Sackgasse der klandestinen Selbstisolation herauskommen und Gesicht zeigen.
„Bakunin, der grosse Verkünder der individuellen Freiheit, die er jedoch stets nur im Rahmen der Interessen der Allgemeinheit auffasste, anerkannte auch vollständig die Notwendigkeit einer gewissen Unterordnung der einzelnen unter freiwillig gefasste Beschlüsse und allgemeine Richtlinien als im Wesen der Organisation begründet. Er erblickte in dieser Tatsache keineswegs eine „Vergewaltigung der freien Persönlichkeit“, wie so manche verknöcherten Dogmatiker, die, berauscht von einem halben Dutzend leerer Schlagworte, niemals in das eigentliche Wesen der anarchistischen Ideengänge eingedrungen sind, trotzdem sie sich stets mit lauter Aufdringlichkeit als die Gralswächter der „anarchistischen Prinzipien“ aufspielen.“
– Rudolf Rocker, Anarchismus und Organisation (1921)